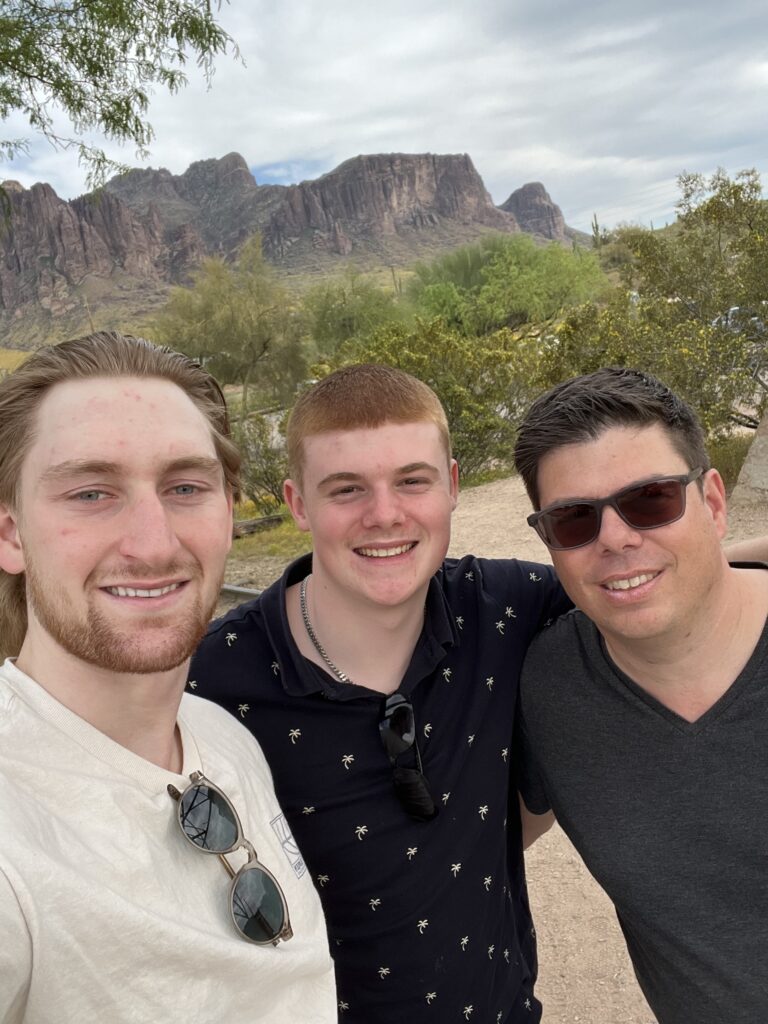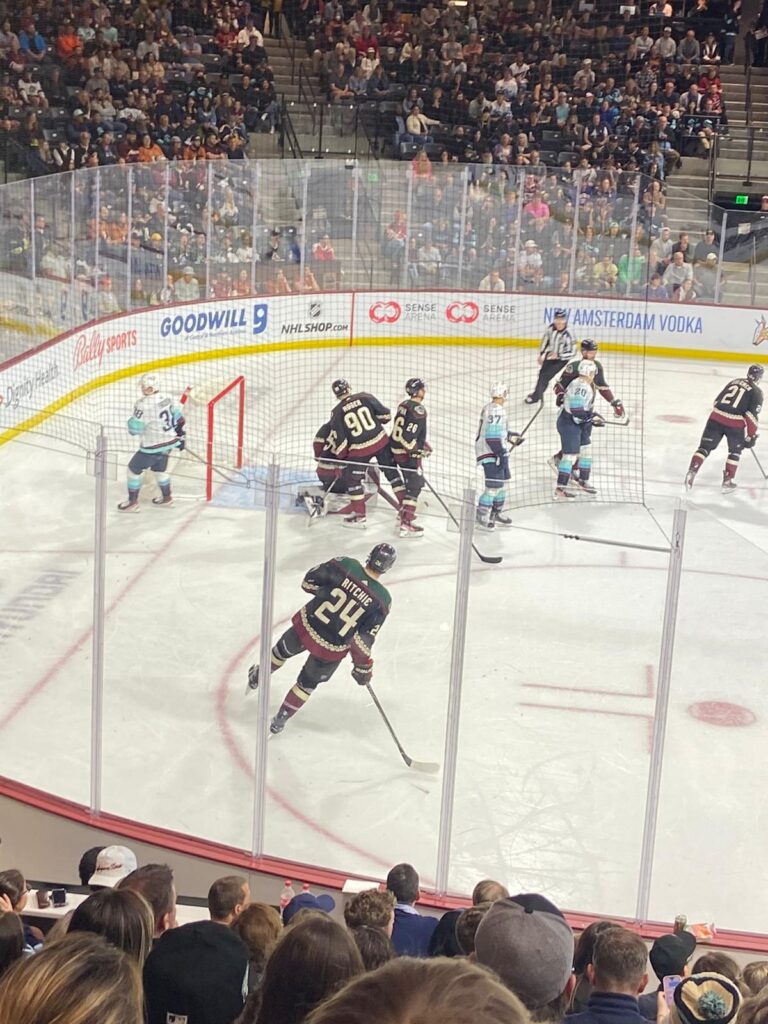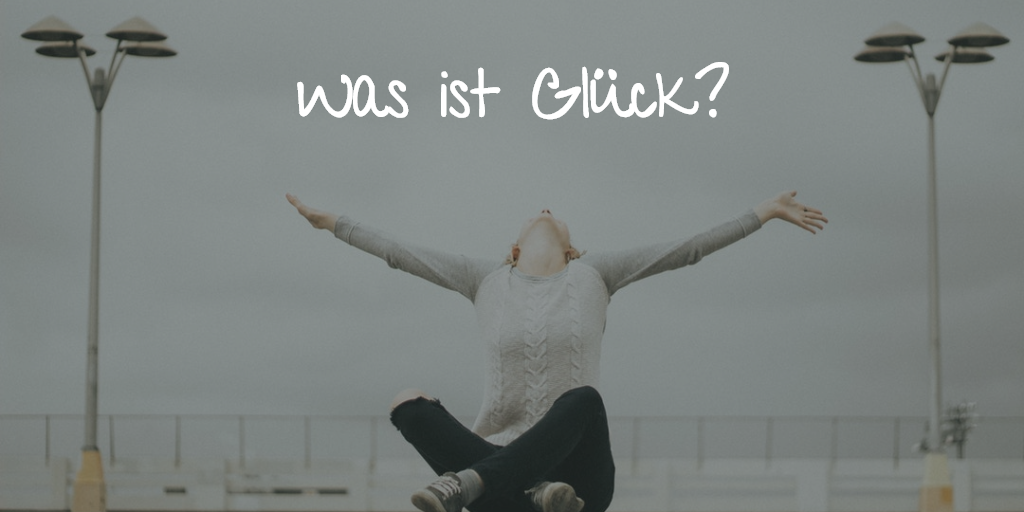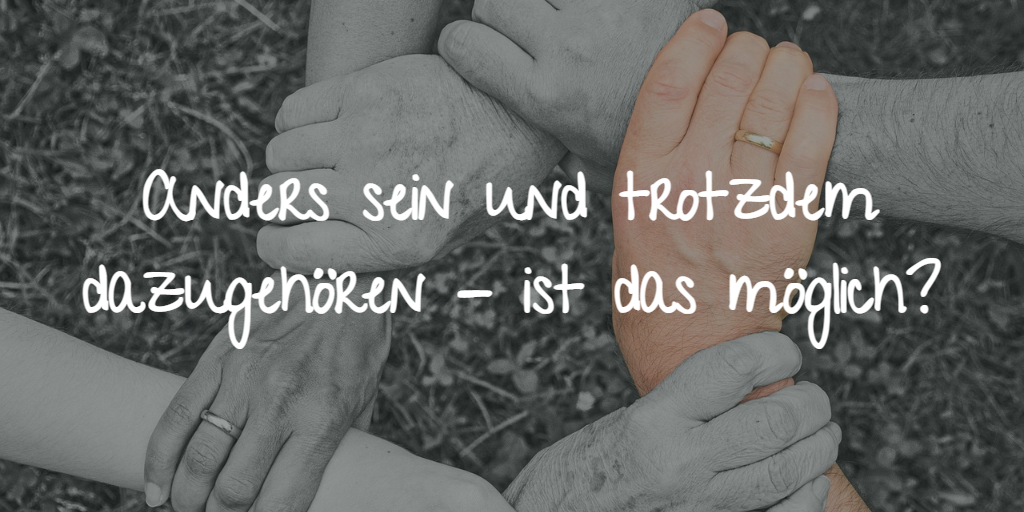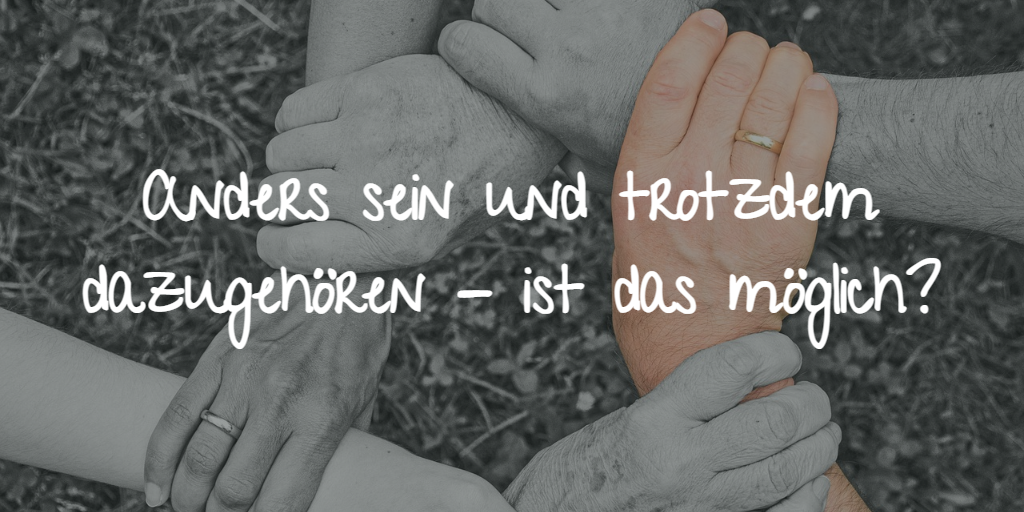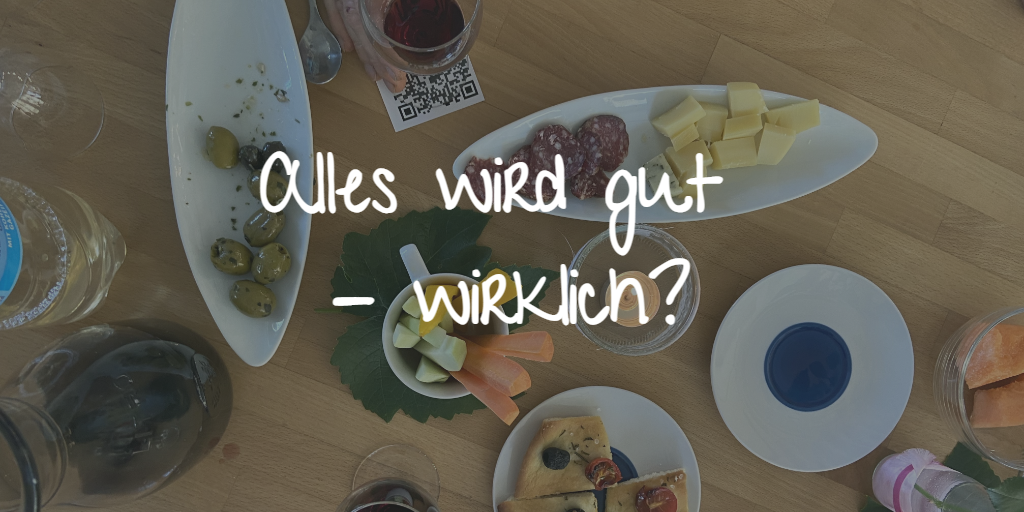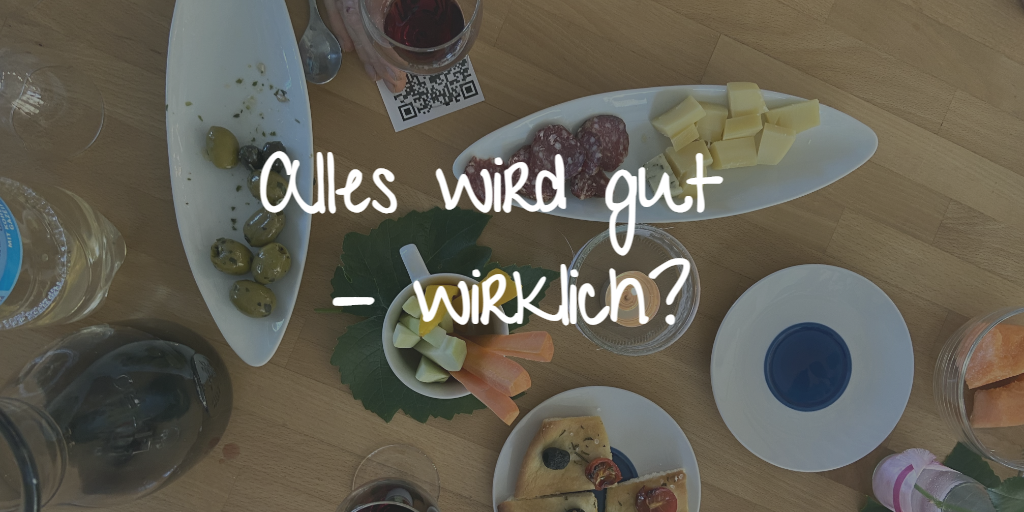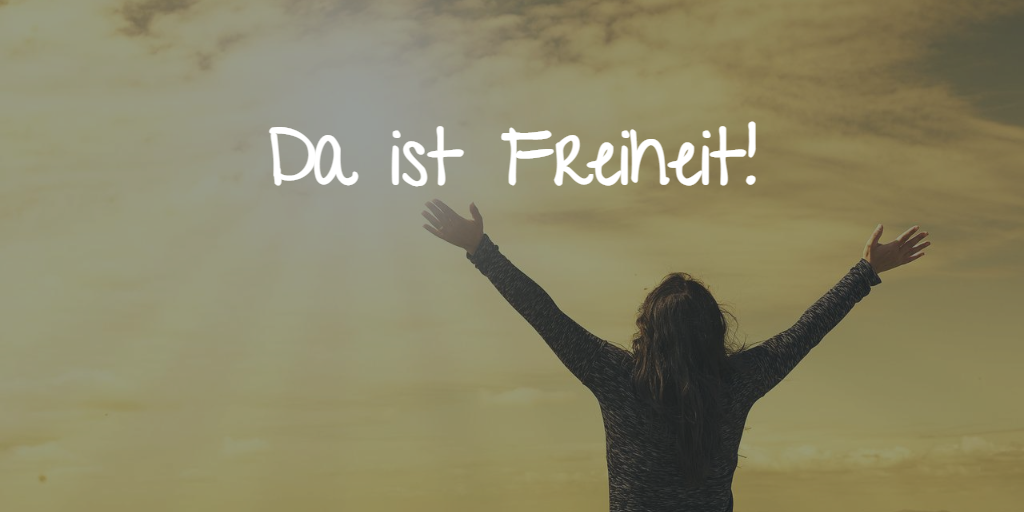Das war die beste strategische Entscheidung der letzten Monate: Für meine neue regionale Aufgabe entschied ich mich, wenn möglich einen halben Tag pro Woche in einem gemütlichen Kafi in Lyss zu verbringen. Dies mit der Idee, Menschen zu treffen und Anknüpfungspunkte zu finden.
Also bin ich aktuell am Mittwochmorgen regelmässig im Mona Lysa anzutreffen. Und so habe ich natürlich die Inhaberin, Renä, näher kennengelernt. Eine sympathische Gastgeberin mit grossem Herzen – und eine richtige Influencerin.
Wir alle sind Influencer!
Ganz einfach, weil wir alle Einfluss haben und Menschen prägen.
Du zweifelst noch, ob du ein:e Influencer:in bist?
Hast du Kinder?
Dann gehörst du zu den Top-Influencer!
Sind dir am Arbeitsplatz Menschen anvertraut?
Du bist eine Influencerin!
Übernimmst du irgendwo in der Gesellschaft Verantwortung (Verein, Politik …)?
Willkommen in der Welt der Influencer:innen!
Lebst du Freundschaften?
Dann prägst du andere Menschen!
Oder eben, du führst wie Renä ein Kafi oder einen Laden und der Kundenkontakt ist dein tägliches Brot. Dann bist du definitiv ein:e Influencer:in.
Im Mona Lysa fühlt man sich einfach willkommen. Natürlich hilft das gemütliche Ambiente. Aber vor allem liegt dies an der Willkommens-Kultur, die Renä lebt: Ein offenes Ohr für Menschen, die ihr etwas anvertrauen, was sie aktuell bedrückt. Ein ermutigendes Wort für Besucher:innen, die gerade in besonderen Herausforderungen stecken.
Und was sie perfekt beherrscht: Sie ist eine top Vernetzerin. Unaufdringlich und doch konkret einladend bringt sie Menschen zueinander. So hat mir beispielsweise diese Woche ein Freund geschrieben: «Dank Renä bin ich mit einer Person ins Gespräch gekommen und wir haben festgestellt: Wir haben die gleichen Bücher in derselben Reihenfolge gelesen …»
Ich finde es fantastisch, wie Renä sich als Instrument der Liebe Gottes benutzen lässt! Genau solche Influencer:innnen, ob mit tausenden Follower:innen oder mit täglichem Kundenkontakt, braucht unsere Welt! Influencer:innen der Liebe statt Influencer:innen der Spaltung!
Nutz deinen Einfluss für das Gute!
Kürzlich beschäftigten wir uns an der gms Matinée auch mit dem Thema «Alle sind Influencer». Dazu schauten wir uns diesen Clip von Coldplay an:
Natürlich ist Chris Martin ein Influencer von einem etwas anderen Kaliber als wir oder Renä es sind. Der Clip ist ein eindrückliches Beispiel, welche Macht ein solcher Influencer haben kann:
50’000 Leute, manchmal sogar über 100’000 Leute, singen deine Lieder.
Wenn du ein bestimmtes T-Shirt trägst, wolle es alle haben.
Wenn du zum Angriff rufst, wird das Capitol gestürzt.
Darum hab ich einen doppelten Rat, wenn es um unseren Umgang mit so mächtigen Influencer:innen geht: Bleiben wir kritisch und prüfen alles. Je grösser die Influencer-Bühne ist, desto einfacher bahnen sich Unwahrheiten und Verschwörungstheorien ihren Weg.
Und zweitens: Beten wir für sie. Ja, ich weiss, das klingt jetzt sackfromm. Aber die «Macht der Mächtigen» ist so riesig – da kann es nicht verkehrt sein, wenn wir in unseren Gebeten an diese Top-Influencer:innen denken.
Nun nochmals zurück zu dir und mir: Unsere Bühnen mögen um ein Vielfaches kleiner sein als die von Chris Martin. Aber dir und mir sind Menschen anvertraut und damit haben wir Einfluss. Nutzen wir ihn für das Gute!
Liebe statt Hass
Freude statt Griesgrämigkeit
Grosszügigkeit statt Eifersucht
Hoffnung statt Angst
Treue statt Verrat
Geduld statt Verbissenheit
Selbstbeherrschung statt Zügellosigkeit
Friede & Gerechtigkeit statt Krieg & Ausbeutung
Und warum war es jetzt strategisch eine so gute Entscheidung, mittwochs im Mona Lysa abzuhängen? Weil auch ich durch die Vernetzerin und Influencerin Renä mit mir bisher unbekannten Menschen in Kontakt gekommen bin und meine Arbeit weitere Kreise zieht, die sich mir ohne Renä wohl kaum erschlossen hätten.
Danke, Renä!
Glücksaufgabe
Bist du dir bewusst, wo du Influencer:in bist? Wenn du magst, schreib auf eine Karte die Menschen(gruppen) auf, die dir anvertraut sind: Kund:innen, Kinder, Mitarbeitende, Nachbarn …
Und dann dreh die Karte und schreib auf die leere Seite auf, wie du diesen Einfluss für das Gute nutzen willst.
Übrigens, meine Predigt Alle sind Influencer kannst du jetzt auch im Matinée-Podcast nachhören.