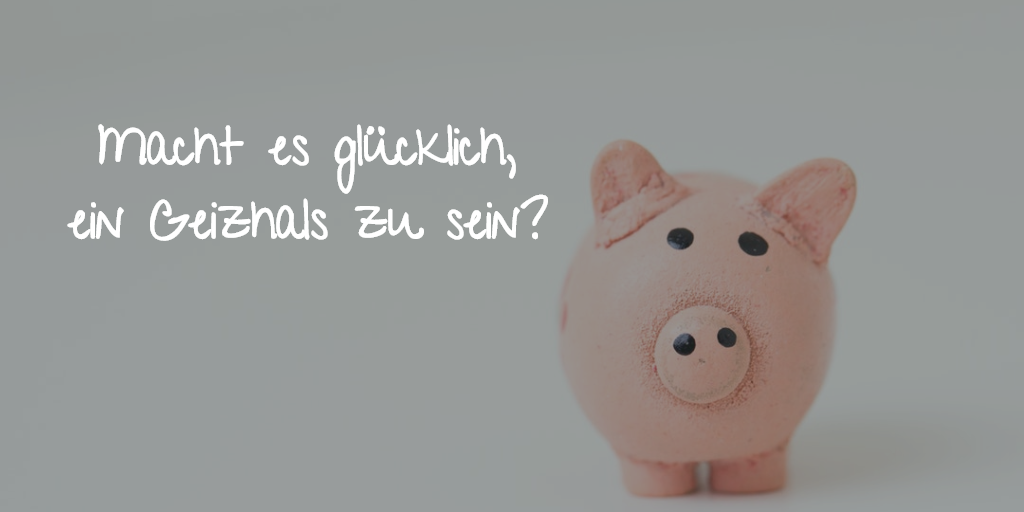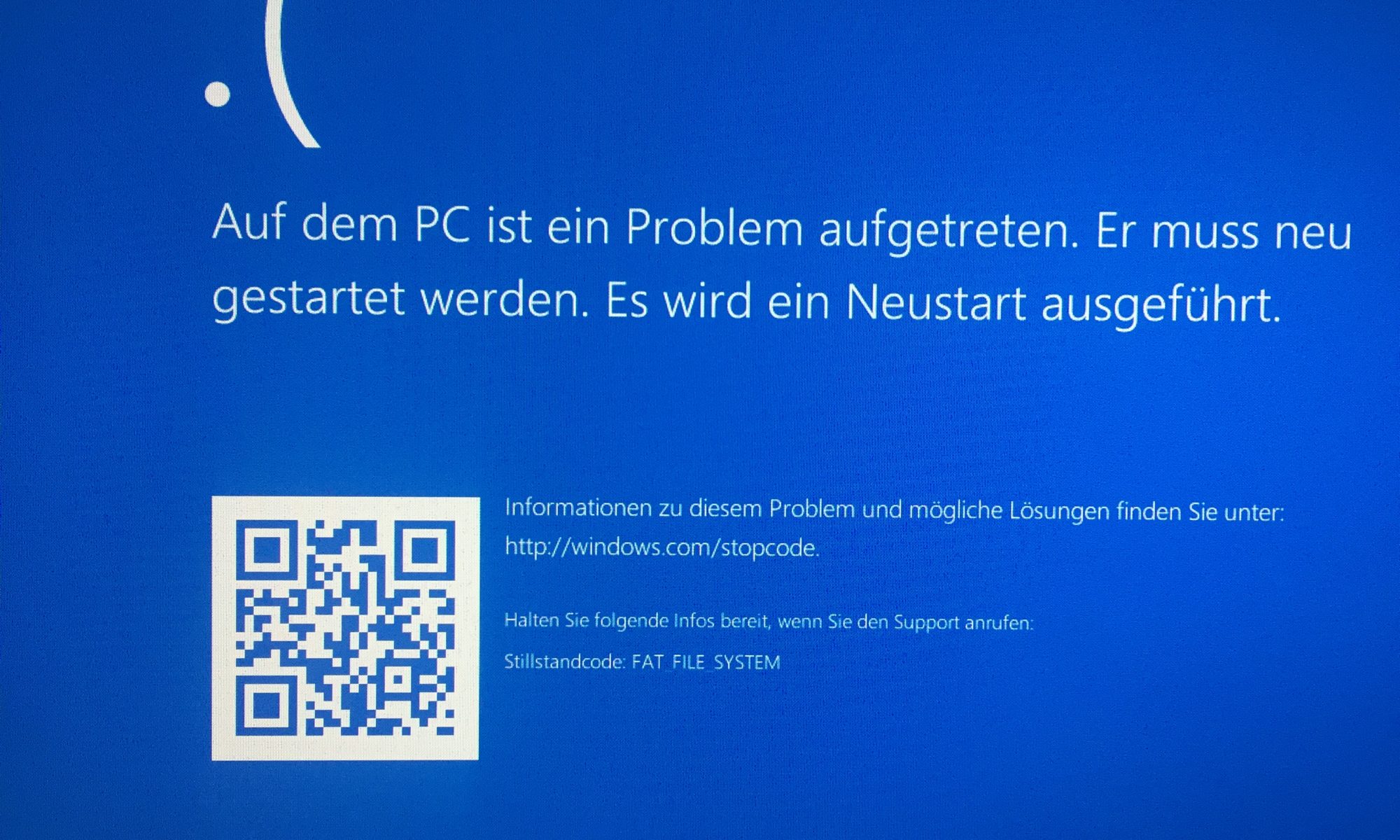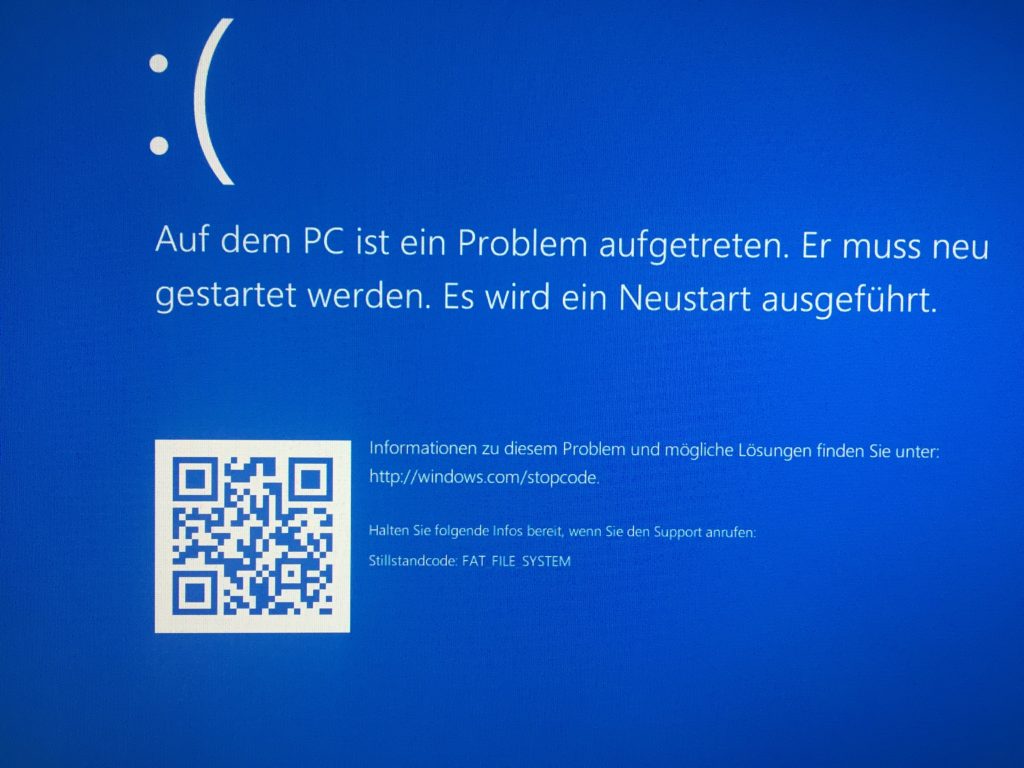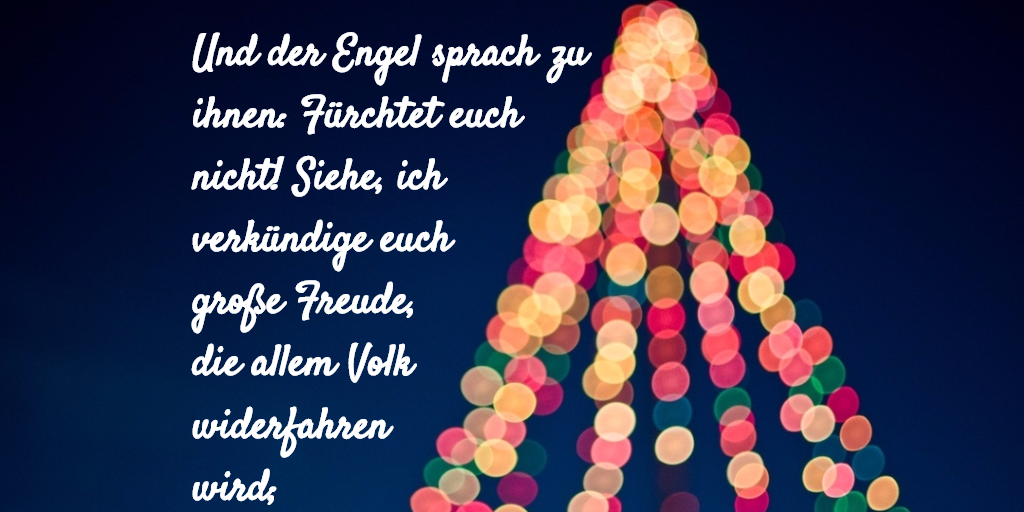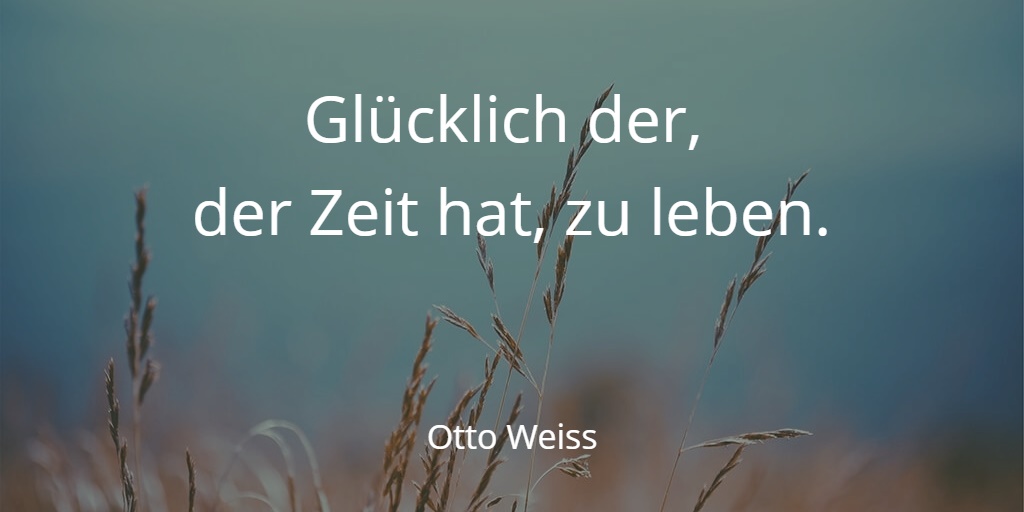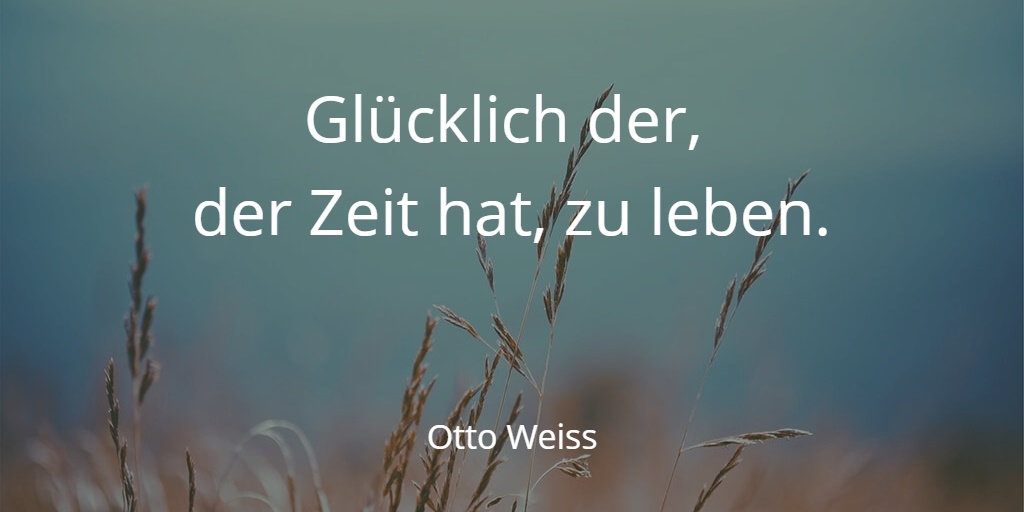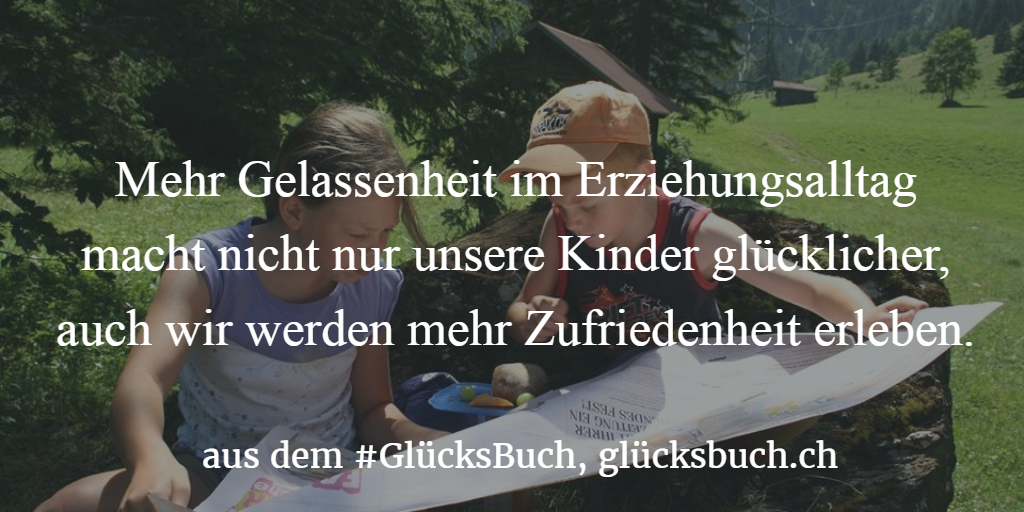Diese Woche habe ich folgendes Shakespeare-Zitat gelesen:
Ein Geizhals wird reich dadurch, dass er arm erscheint;
ein verschwenderischer Mensch wird arm dadurch,
dass er reich erscheint.
William Shakespeare
Nach dem Lesen des Zitates stieg in mir die Frage auf: Was ist jetzt besser? Ein Geizhals oder ein verschwenderischer Mensch? Naja, was das Bankkonto angeht, ist die Sachlage klar: Beim Geizhals lernt man sparen, beim verschwenderischen Menschen sicherlich nicht.
Doch es gibt auch einen anderen Blick auf die Angelegenheit: Welcher der beiden erfährt wohl mehr Glück in seinem Leben? Macht es glücklich, ein Geizhals zu sein? Und wie fühlt es sich an, verschwenderisch zu leben?
Vielleicht fragst du dich grad wie ich mich, wo dieser Artikel hinführen soll … Kann doch nicht sein, dass hier ein verschwenderischer Lebensstil befürwortet wird.
Tatsächlich weigert sich in mir als Ex-Banker, aber auch als Theologen alles dagegen, einen verschwenderischen Lebensstil, der uns in die Armut treibt, zu propagieren. Ich hab zu oft gesehen, welche Last es ist, wenn Menschen nicht mit dem Geld umgehen können und von einer Schuldenfalle in die nächste kippen.
Nein, diese Form des verschwenderischen Umgangs mit Geld kann ich nicht befürworten.
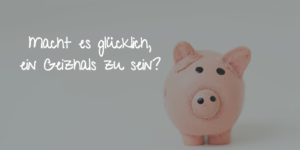
Aber auf der anderen Seite eine Lobeshymne auf den Geizhals zu singen, das kann ich auch nicht.
Einerseits finde ich „Vollblut-Geizhälse“ unsympathisch. Dazu kommt noch, dass ich auch nicht glaube, dass „Geiz geil“ ist (wie es eine Werbekampagne vorgaukelte). Unser Hirn, so hat es die Glücksforschung herausgefunden, begünstigt nicht Egoismus sondern Grosszügigkeit.
Mag sein, dass es einer, der nur auf sich schaut, oberflächlich betrachtet weiterbringt – zum Beispiel auf der Karriereleiter. Doch der Neurobiologe Tobias Esch bestätigt: Glück und Erfüllung findet der, der nicht nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist, sondern aktiv Nächstenliebe übt. Oder in den Worten von Prof. Dr. med. Tobias Esch ausgedrückt: «Menschen, die freiwillig helfen, mehr spenden und verschenken, und solche, denen andere vertrauen, diese Menschen sind glücklicher!»
Also, es muss wohl zwischen dem Geizhals und dem verschwenderischen Menschen noch einen dritten Weg geben. Und das ist eine der 16 Glücksaktivitäten – die Grosszügigkeit!
Wer dankbar ist für alles, was ihr/ihm anvertraut ist, wird auch gerne einen grosszügigen Lebensstil pflegen. Und das macht dann gleich mehrfach glücklich.
Sparsamkeit ist wichtig. Nicht über seinen Verhältnissen leben, ist eine sehr wichtige und wertvolle Tugend. Trotzdem kann jeder, egal, welche materielle Möglichkeiten er hat, die Glücksaktivität Grosszügigkeit ausleben. Wer eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten besitzt, kann möglicherweise Mitmenschen mit Zeit beschenken: Zuhören, Anteil nehmen, kleinere oder grössere Dienste im Freundeskreis oder für die Allgemeinheit.
Der Egoist ist bedauernswert: Er hat immer das Gefühl, zu kurz zu kommen. Der Grosszügige hingegen, wird glücklich, egal wie gross sein Polster auf dem Bankkonto ist: Er fühlt sich so reich beschenkt, dass er gerne mit anderen teilt – und damit sich und seine Mitmenschen glücklich macht!
Glücksaufgabe
Das Projekt Change Moment zeigt, wie schön es ist, andere zu beschenken. Ich hab es auch schon ausprobiert: Einmal kaufte ich an einer Theke zwei Ragusas – eines für mich und eines für die Person, die mich gerade bedient hat. Das hat uns beiden ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Probier es aus, lebe Grosszügigkeit und staune, was passiert!
Glück finden – hier und jetzt
Das praktische GlücksBuch von Stefan Gerber jetzt bestellen.
Adonia Verlag, CHF 19.80, ISBN 978-3-03783-104-5
184 Seiten
Jetzt bestellen! / Bestelllink für Deutschland
Bald ist UNO-Tag des Glücks (20. März). Wem könntest du das GlücksBuch schenken?
Das Hamsterrad mit dem Windrad austauschen – wie geht das? Wärmstens empfehle ich Ihnen die Anleitung dazu in Stef Gerbers Buch „Glück finden“! Gekonnt integriert der Autor zentrale Befunde zu Glücksfaktoren aus der Theologie und Psychologie und ergänzt sie mit seinen persönlichen Erkenntnissen. Das mit Weisheit vollbepackte Buch ermutigt nicht nur zu einem glücklichen Leben, sondern leitet anhand klar verständlicher Gedanken an zu einem ShalomLeben – ein versöhntes Leben, in welchem wir Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und Ganzsein erleben. Wer die praktischen ShalomLeben-Tipps, welche jedes Kapitel abrunden, in seinem Leben umsetzt, wird Glück finden. Probieren auch Sie es aus!
Dr. Barbara Studer-Lüthi, Leitende Psychologin und Dozentin