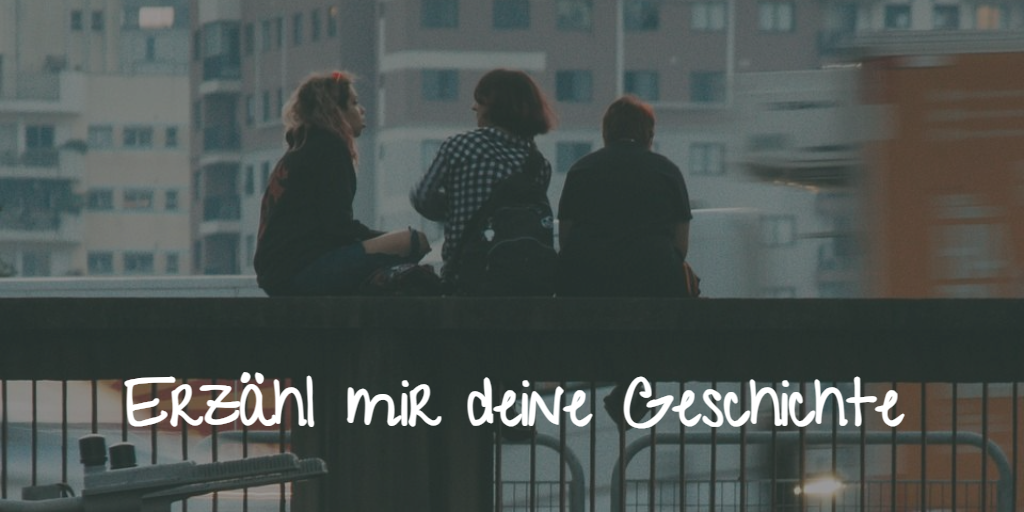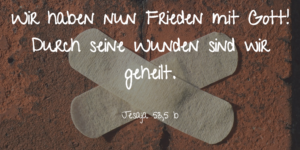Ja, ich weiss, das klingt viel zu simpel. Und überhaupt: Ist der Glaube wirklich für unser Glück zuständig? Was heisst schon Glauben? Und vielleicht noch schwieriger: Was ist schon Glück?
Wer hier regelmässig vorbeischaut, hat hoffentlich eine Ahnung von dem, was ich unter Glück verstehe. Es geht mir nicht um ein Leben im ständigen «Happy Hour»-Modus – nicht Easy-Life ist das Ziel, sondern ein ganzheitliches Wohlbefinden und eine Lebenszufriedenheit, in der wir mit dem Schönen und Schwierigen unseres Lebens versöhnt sind, sind gemäss meiner Glücks-Definition und der Idee vom «Shalom-Leben» anzustreben.
Und dazu haben diese Woche zwei Artikel meine Aufmerksamkeit in besonderem Masse geweckt.
Die eine Quelle der Inspiration war, wie so oft, die NZZ am Sonntag. Peer Teuwsen hält uns mit seiner Kolumne «Die Schamlosigkeit hat auch mit uns zu tun» knallhart den Spiegel vor die Nase: Zu einfach sei es, sich an der Schamlosigkeit des neuen politischen Stils zu empören. Und in Vergessenheit geraten sei sie, die Volksweisheit, «dass Bescheidenheit eine Zier sein kann. Dass es christliche Pflicht ist, zu Lebzeiten Gutes zu tun, vor allem anderen, nicht bloss sich selbst.»
Was er stattdessen beobachtet, wirkt wie entblössende Gesellschaftskritik:
Die Zeichen der Zeit sind andere. Viele Schweizerinnen und Schweizer ramassieren, was sie nur bekommen können. Sie reisen in einer Kadenz in ferne Länder, als hätten sie Krebs im Endstadium und wollten ein letztes Mal die Schönheit der Welt bestaunen. … Sie verkaufen ihre Häuser und Wohnungen einfach an den Meistbietenden. Man wählt links und investiert sein Geld, das nicht selten ein geerbtes ist, gleichzeitig in Aktien von Waffenherstellern. Hauptsache, die Rendite stimmt.
Gnadenlos fällt das Fazit aus: «Mehr Widerspruch und weniger Engagement für das Gemeindewohl waren selten. Nur eins scheint klar: Alle wollen mehr von allem. Haben statt Sein.»
Nein, es ist nicht mein Stil, hier mit den Ausführungen von Peer Teuwsen den moralischen Zeigefinger aufzustrecken und über den katastrophalen Zustand der Gesellschaft zu lamentieren. Einerseits gibt es natürlich neben diesen, vom Autoren selbst so benannten, überspitzen Aussagen ganz viel schöne Beispiele die von Mitmenschlichkeit, Grosszügigkeit und Gemeinschaftssinn zeugen – auch in unserer Zeit.
Anderseits will ich nur fragen, ob uns der egozentrische Lebensstil der Schamlosigkeit wirklich nachhaltig glücklich macht. Mag die dritte Kreuzfahrt oder der fünfte Städtetrip innerhalb eines Jahres wirklich unser Wohlbefinden nachhaltig verbessern?

Da kommt der zweite Artikel ins Spiel. Im Dienstagsmail war diese Woche zu lesen:
Spiritualität ist eine wichtige Ressource für das Leben – in vielen Bereichen eine Wohltat. Ein christlicher Lebensstil reduziert die Sterblichkeit und ist ein Jungbrunnen bezüglich Langlebigkeit (Longevity). … Neue Studien zeigen auch, dass die feste Zugehörigkeit zu einer Kirche dem Leben gut tut. Die Teilnahme an Gottesdiensten kann die Gesundheit fördern, weil sie soziale Integration verbessert, gesundheitliche Verhaltensweisen reguliert, ein Gefühl von Sinn vermittelt und den Charakter stärkt.
Ich will nicht verheimlichen, dass Glaube auch krank machen kann. Doch die Glücksforschung hat längst entdeckt, dass nicht Egoismus, sondern Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit uns nachhaltig glücklich machen. Und genau das, verbunden mit einer Transzendenzerfahrung, also der Verbindung mit dem Göttlichen, ist die grosse Chance einer Glaubensgemeinschaft.
Es ist mein Traum und mein Bestreben, Räume zu schaffen, in denen unterschiedlichste Menschen genau das erleben dürfen.
Glücksaufgabe
Wo fühlst du dich vielleicht ertappt in den gesellschaftskritischen Ausführungen von Peer Teuwsen? Macht dich immer mehr haben zu wollen statt mehr in Verbundenheit zu sein wirklich zufriedener?
Und wie hast du es mit dem Glauben? Macht er dich glücklich? Vielleicht magst du ja mal ausprobieren, ob die Studien wirklich recht haben …
Übrigens, auch wenn mein GlücksBuch bald sein 10jähriges Jubiläum feiert, die Frage nach dem Glück bleibt aktuell: Glück finden – hier und jetzt.