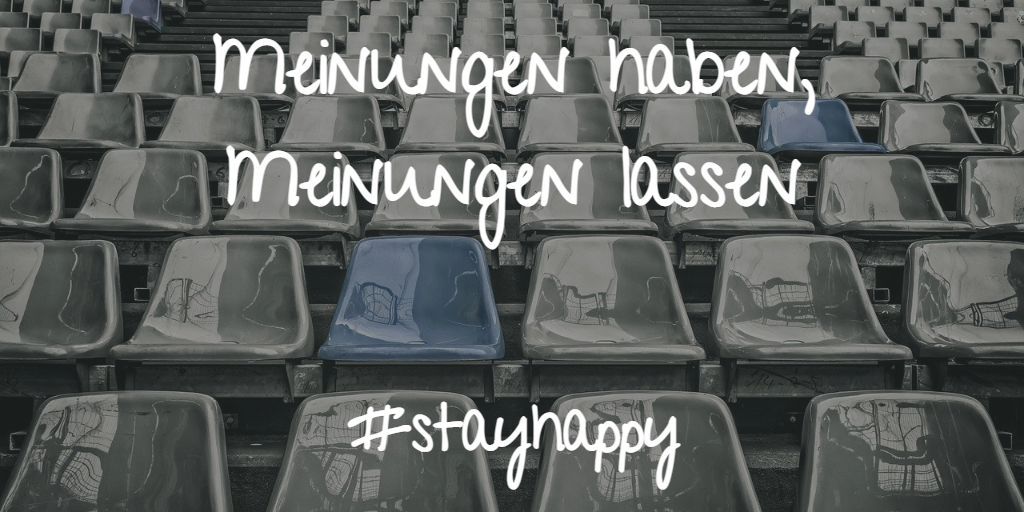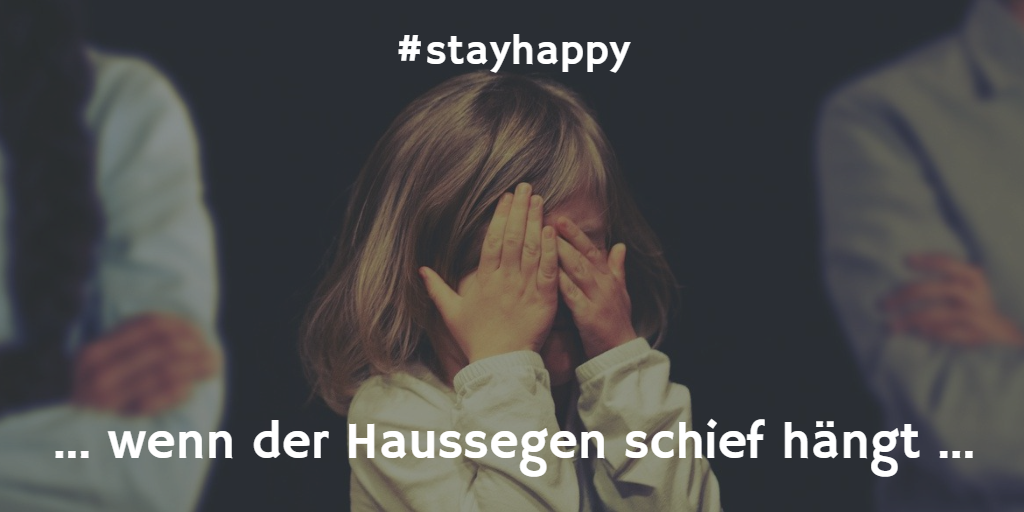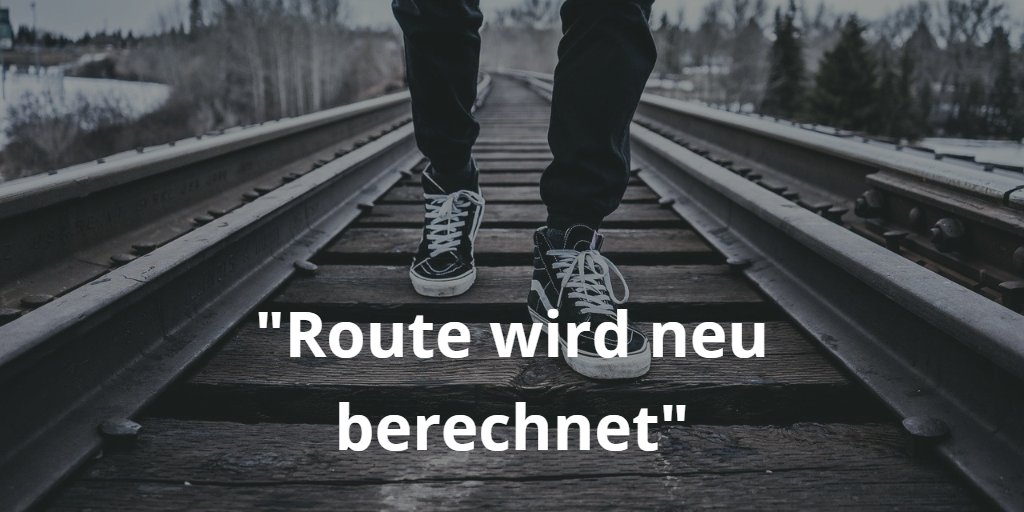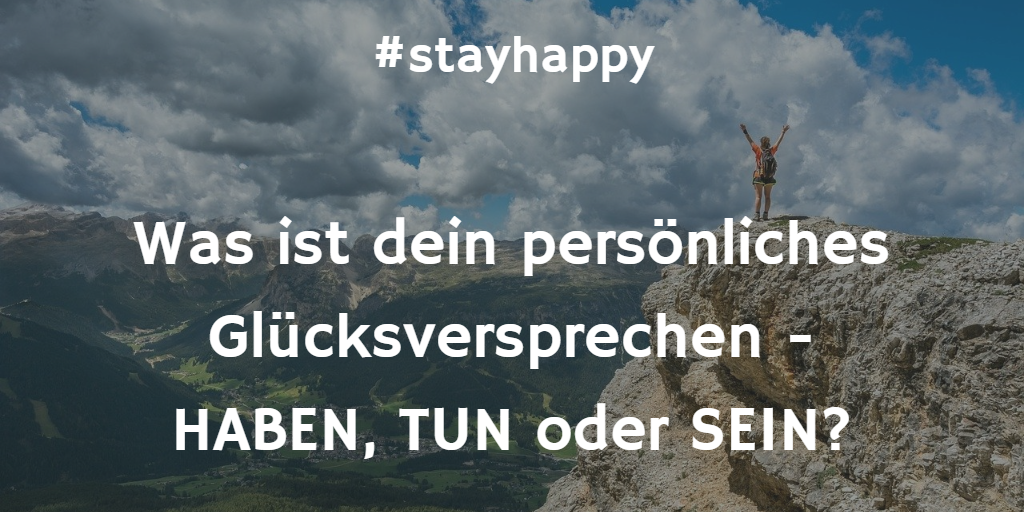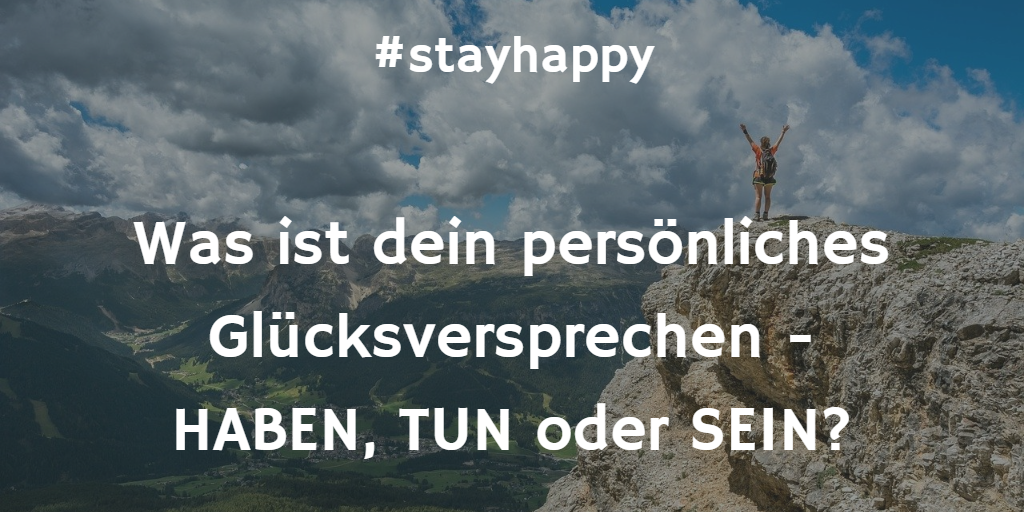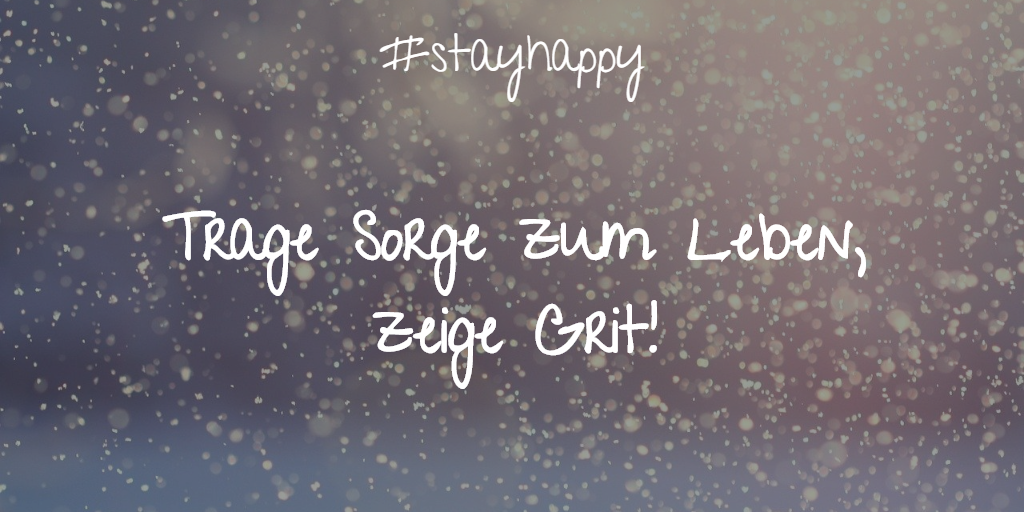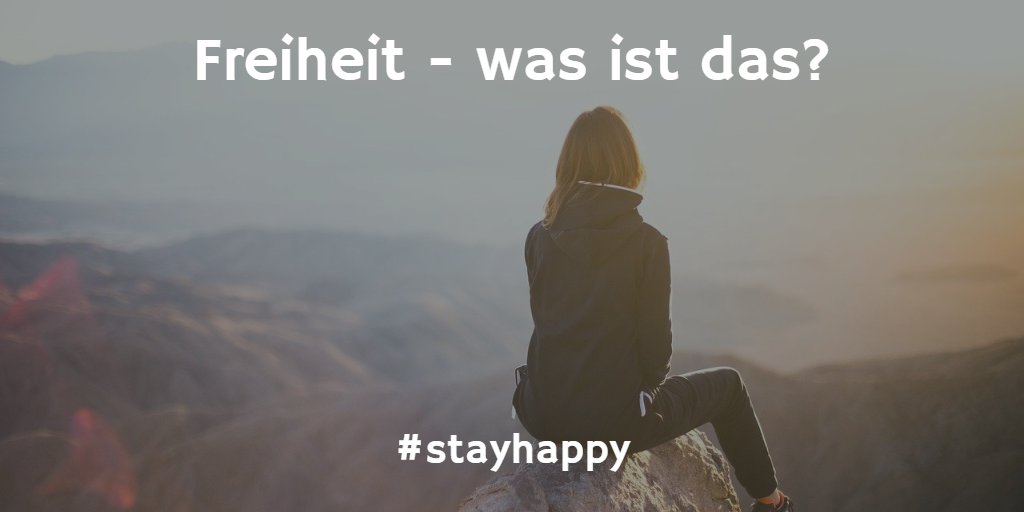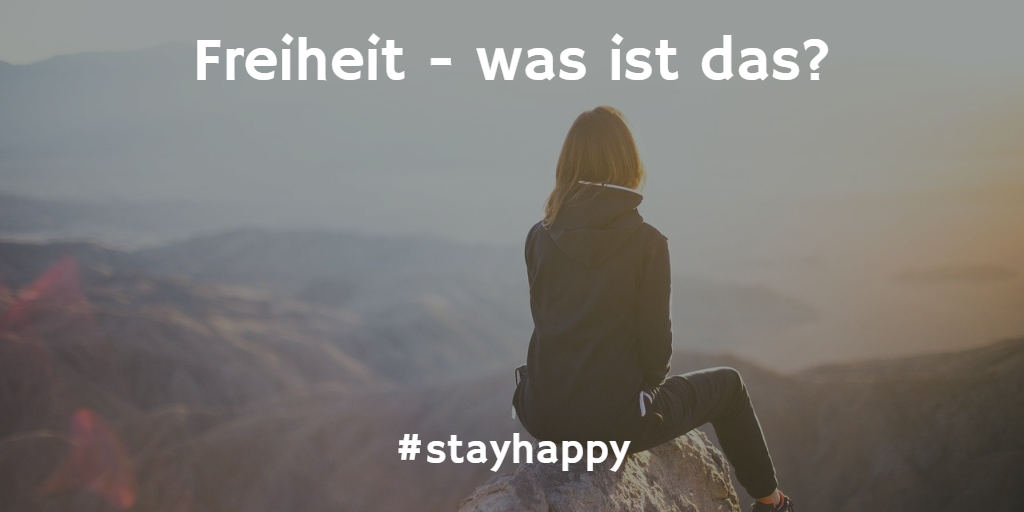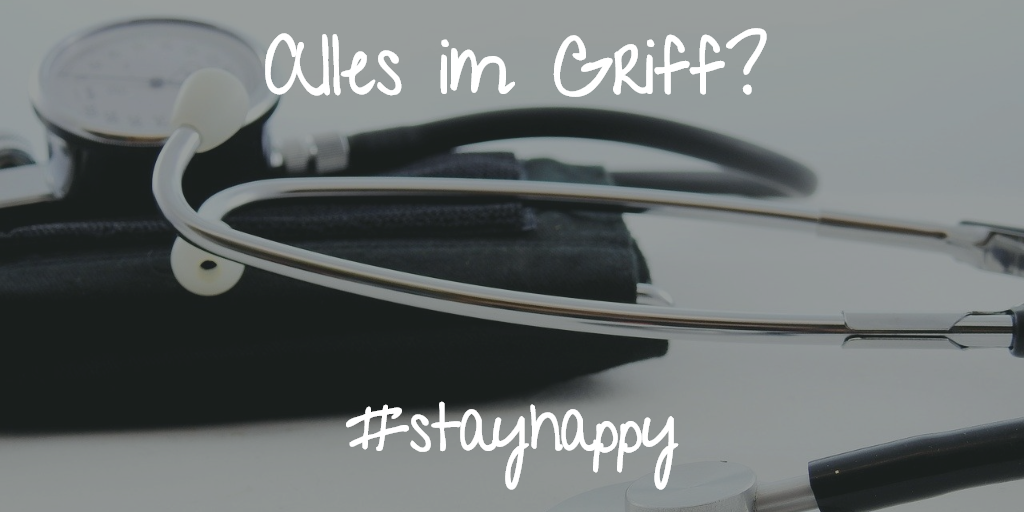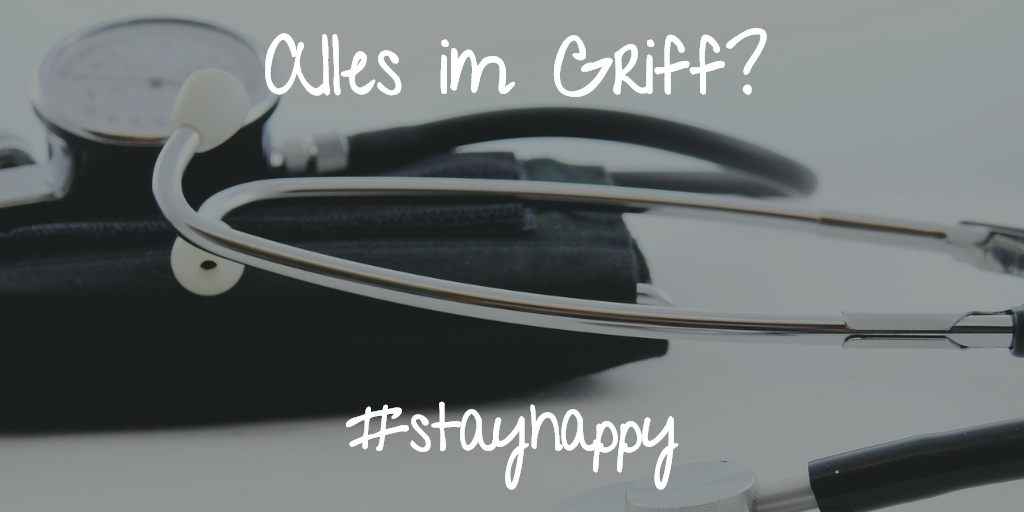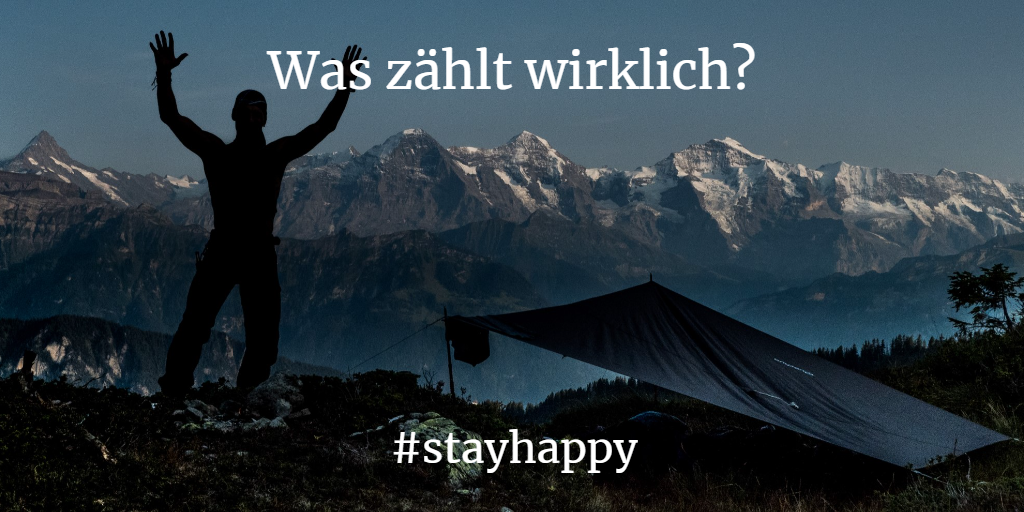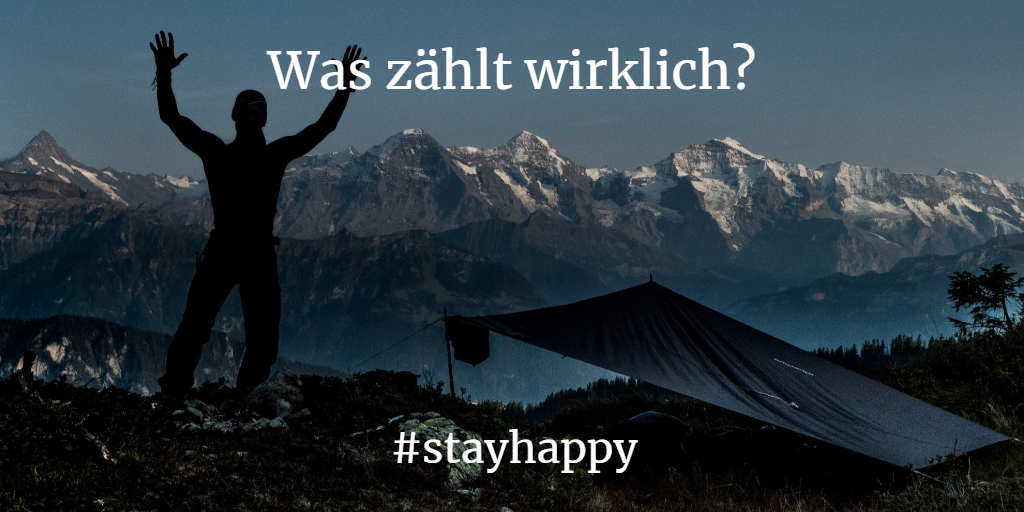Was vermisst du gerade am meisten?
Ich würde gerne wieder einmal einen Hockey-Match besuchen. Vielleicht sogar mit einem gemütlichen Fondue unter Freunden im Voraus, dann die Stimmung in der vollen Tissot Arena geniessen, einem spannenden Spiel zuschauen und hoffen, dass Janis Moser mal wieder ein Geniestreich gelingt und „meine Mannschaft“ zum Sieg führt.
Ist das Spiel umkämpft, gehen auch die Emotionen hoch. Das gehört irgendwie dazu. Die Spannung geniesse ich, doch für mich gibt es auch Grenzen: Das eigene Team unterstützen ja, den Gegner anfeinden nein.
In einer aufgeladenen Stimmung stimmt man natürlich schneller als einem lieb ist mit in den Fangesang ein und provoziert den Gegner – wie damals, als der Berner Goali Renato Tosio nach einer Fan-Provokation im ehrwürdigen Bieler Eisstadion zu kochen begann, sich umdrehte und der gesamten Fankurve den Stinkefinger zeigte.
Was passiert, wenn sich ein Leader wie Tosio provozieren lässt und mit einer solchen Geste Öl ins Feuer giesst, kann man sich leicht ausmalen.
Oft bleibt es im Sportstadion und auch sonst im Leben – oder auf Social Media – zum Glück bei verbalen Entgleisungen. Wobei auch diese unter Umständen tiefe Spuren der Verletzung anrichten können.
Wenn aber verbale Provokationen zu Vandalismus und physischer Gewalt ausufert, ist der Schaden definitiv angerichtet.
Ist es noch ein Genuss, wenn Fangruppen durch eine Hundertschaft von Polizisten in Vollmontur voneinander getrennt werden müssen?
Ich liebe ein fantastisches Hockeyspiel und ja, ich würde mich durchaus als Fan vom EHC Biel bezeichnen – heute geht das auch ganz gut ohne entsprechende Fanutensilien und Trikot. Man kann ja auch so mit dem Herzen dabei sein.
Nicht verstehen kann ich, wenn aus einer begeisterten Fankultur ein Fanatismus wird – in Sport, Politik oder Religion.
Respekt vor dem Gegenüber – auch wenn es anders denkt als ich
Doch, verstehen kann ich es vielleicht sogar: Da gibt es etwas, das einem so wichtig ist, dass man es um jeden Preis und gegen alles andere verteidigen will. Und irgendwann kippt das FÜR-etwas-Einstehen in ein GEGEN-etwas-Ankämpfen.
Plötzlich wird aus meinem FÜR-den-EHCB-Fanen ein GEGEN-den-SCB-Stimmungmachen.
Plötzlich wird aus einem Freidenker ein Christenbekämpfer.
Plötzlich werden aus Lebensschützern fanatische Abtreibungsgegner.
Plötzlich werden aus Menschen mit traditionellem Familienbild Schwulenhasser.
Plötzlich werden aus Trump-Wählern Biden-Hasser.
Plötzlich herrscht Krieg im Kapitol.
Also so plötzlich kommt das alles ja nicht. Wer mit dem Feuer spielt, brennt sich irgendwann. Wer den Respekt vor anderen Meinungen verliert, steht nicht mehr bloss für seine Ansichten ein, sondern bekämpft Andersdenkende. Wer sich getrieben fühlt, sein Weltbild andern zu überstülpen, in dem steckt das Potenzial eines fanatischen Kämpfers.
Ich habe starke Überzeugungen – für die will ich auch öffentlich einstehen.
Mir sind mein Glaube und meine Jesus-Nachfolge sehr wichtig und ich will meine Spiritualität auch zeigen – nicht aufdringlich zur Schau stellen, aber eben auch nicht verstecken.
Was mir wichtig ist: Ich will als einer bekannt sein, der FÜR etwas ist – Glaube, Liebe, Hoffnung, Glück – und nicht als einer, der immer GEGEN etwas ist.
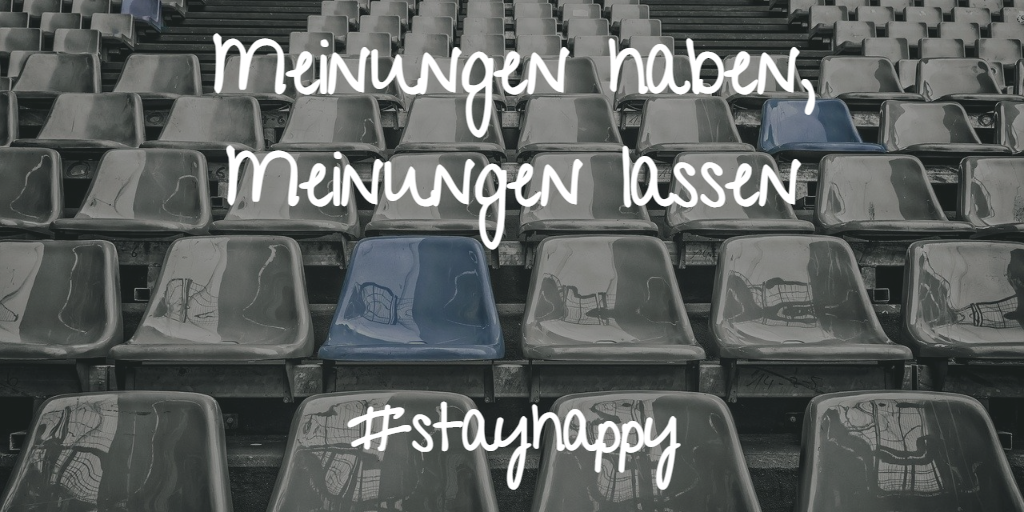
Und ich möchte meinen – ob kleinen oder grossen – Einfluss zum Guten nutzen: Menschen zur Liebe anstiften.
Dass man Menschen auch zu ganz anderem anstiften kann und dass aus fanatischem Gedankengut in Politik zusammen mit fundamentalistischer Religion ein gefährlicher Cocktail wird, haben wir letzte Woche eindrücklich in einem der traurigsten Kapitel der jüngeren US-Geschichte gesehen.
Glücksaufgabe
FÜR was lebst du? Wofür willst du einstehen, was ist dir wichtig? Und wie kannst du für eine Meinung einstehen ohne Andersdenkende anzufeinden?
Und: Ein volles Stadion kann ich leider derzeit auch nicht bieten, aber wenn du wissen willst, was mich beim Talken mit dem Hockey-Star Janis Jérôme Moser letzten Herbst beindruckt hat, kannst du dies hier nachlesen oder den Talk auch gleich nachhören.