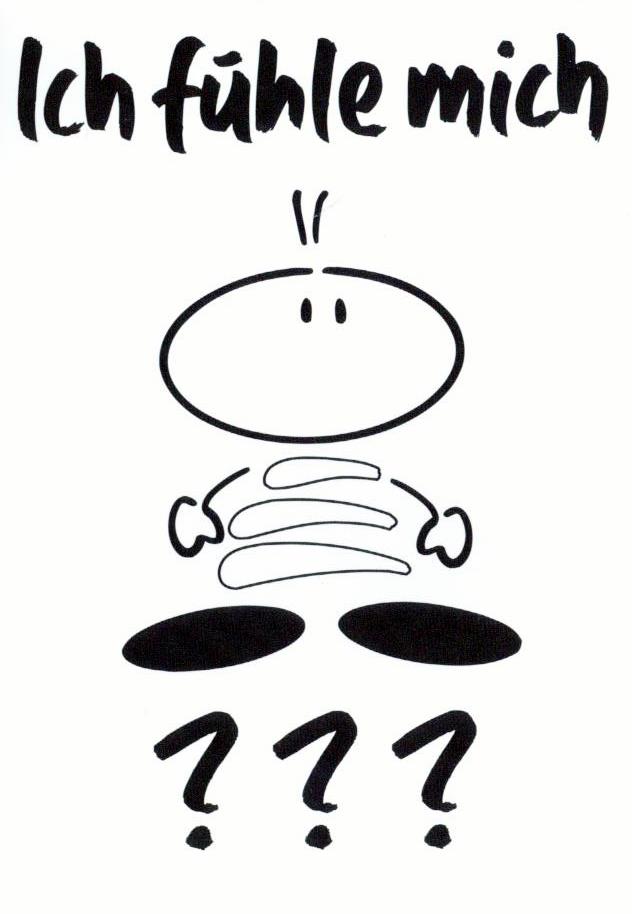Die Krankheit der Rivalität und der Ruhmsucht – wenn das Äußere, die Farben der Kleidung und Zeichen der Ehre zum vorrangigen Lebensziel werden…
Papst Franziskus, in seiner Schelte an die Kurie
Nein, ich bin nicht katholisch. Aber Papst Franziskus hat es mir angetan. Und zwar von der ersten Stunde seiner Wahl an. Ich erinnere mich, wie ich fasziniert war, als er erstmals als Papst auf dem Balkon erschien und die versammelte Gemeinde bat, für ihn zu beten. Was für eine Demut.
In den letzten beiden Jahren war er immer wieder gut für eine Überraschung – ob er tätige Bescheidenheit zeigt oder sich als Brückenbauer zu Randständigen oder Andersdenkenden erweist, immer mal wieder bin ich beeindruckt von diesem Papst.
Ende letztes Jahr war wieder so ein Moment: Überrascht und anerkennend las ich in der NZZ am Sonntag, wie Franziskus seine Mitarbeiter zurecht wies. Gleich 15 Krankheiten hatte er in der Kurie diagnostiziert.
Auffallend dabei: Der Papst attestierte seinen Kardinälen einen schlechten Umgang mit sich selbst und eine tote Spiritualität. Unter Ersterem führte er „Krankheiten“ wie „sich unstebrlich fühlen“, „zu hart arbeiten“, „Trauermine aufsetzen“ oder „nach weltlichen Profiten streben“ auf. Bei der fehlenden Spiritualität bemängelt er fehlende Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes und spricht gar von „Spirituellem Alzheimer“.
Das eigene Wohl – und das meiner Mitmenschen
Das päpstliche Zitat über die Krankheit der Ruhmsucht am Anfang dieses Blogartikels geht wie folgt weiter: „…und man das Wort des heiligen Paulus vergisst: ‚Tut nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei. Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.‘ (Philipper 2,1-4)“
Spannend, dass uns dieser Bibeltext – mindestens nach der Einheitsübersetzung – indirekt dazu einlädt, auf das eigene Wohl zu achten. Nicht nur, natürlich, aber eben auch.
Denn, genau davon hatten wir es kürzlich im SunntigsTräff von „gms – z’friede läbe“, es geht beim berühmten Doppelgebot der Liebe im Grunde um eine dreifache Liebe: Zu Gott, zum Nächsten und zu mir selbst.
In der Gruppendiskussion wollte ich wissen, welches die schwierigste Form der Liebe sei. Nicht verwunderlich, dass viele zu allererst mit der Selbstliebe zu kämpfen haben. Ich glaube, dass gerade hier ein wichtiger Schlüssel zur Nächstenliebe liegt: Erst wer sich selbst liebt, kann dem anderen in uneigennütziger Liebe begegnen. Nicht, weil der andere meine Defizite ausfüllt, liebe ich ihn, sondern weil er wie jedes Geschöpf liebenswürdig ist.
Kann ich mich selbst annehmen und lieben, brauche ich auch keine Ego-Show abzuziehen. Die Krankheiten der päpstlichen Diagnose kann ich abschütteln, wenn ich zur Selbstliebe und zu einem guten Umgang mit mir selbst finde. Ruhmsucht, Prahlerei, Rivalität, sich unsterblich machen, Vorgesetzte vergöttern, Profitstreben… hat nur nötig, wer noch kein Ja zu sich selbst gefunden hat.
Darum: Beginnen Sie, sich selbst zu lieben, damit Sie auch Ihre Mitmenschen lieben können!
Konkret
- Wie unterscheiden sich aus Ihrer Sicht Ego-Show und Selbstliebe?
- Lesetipp: Die Papstansprache in voller Länge.
- Lesen Sie auch Teil 2 zur Papstschelte.
- Blogartikel: Kann ich mich selbst führen?
- Sich selbst als wertvoll betrachten und das Leben als göttliches Geschenk annehmen – dazu laden wir in unseren Coachings und Timeout-Weekends ein.
Mein Blogbeitrag dieser Woche dreht sich um den Lebensbereich “Selbst“.