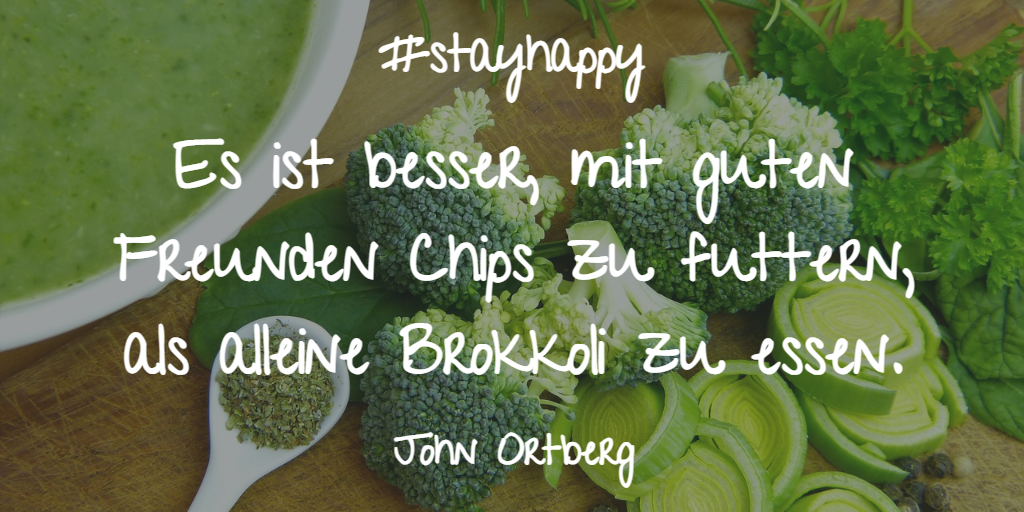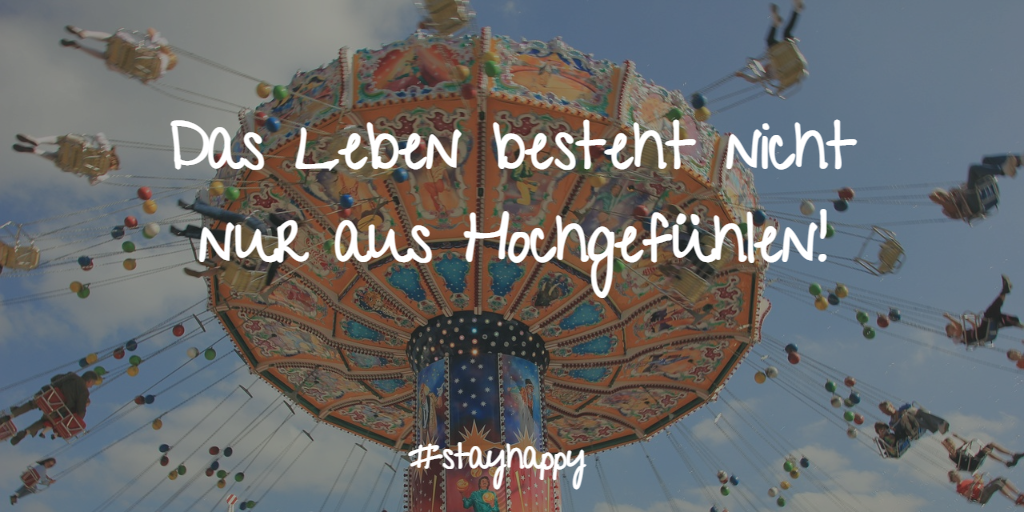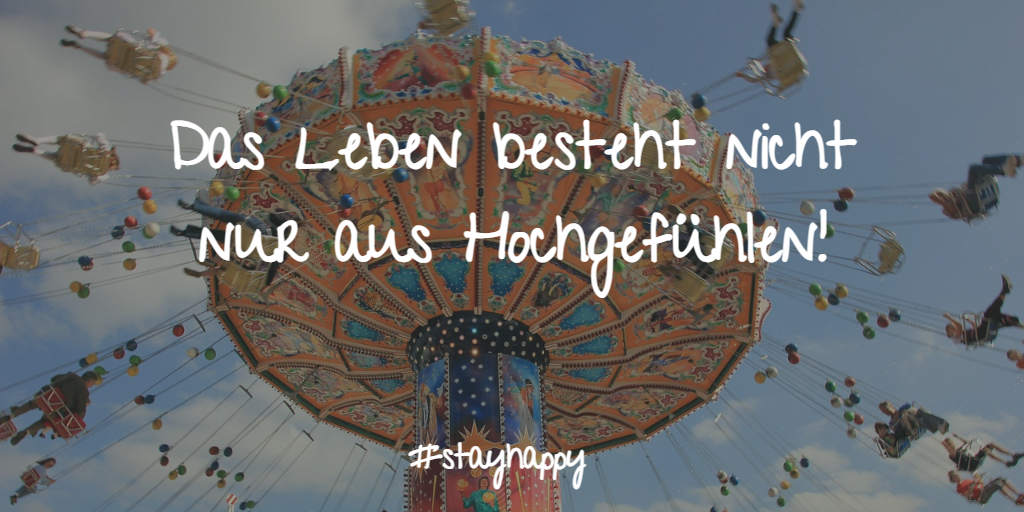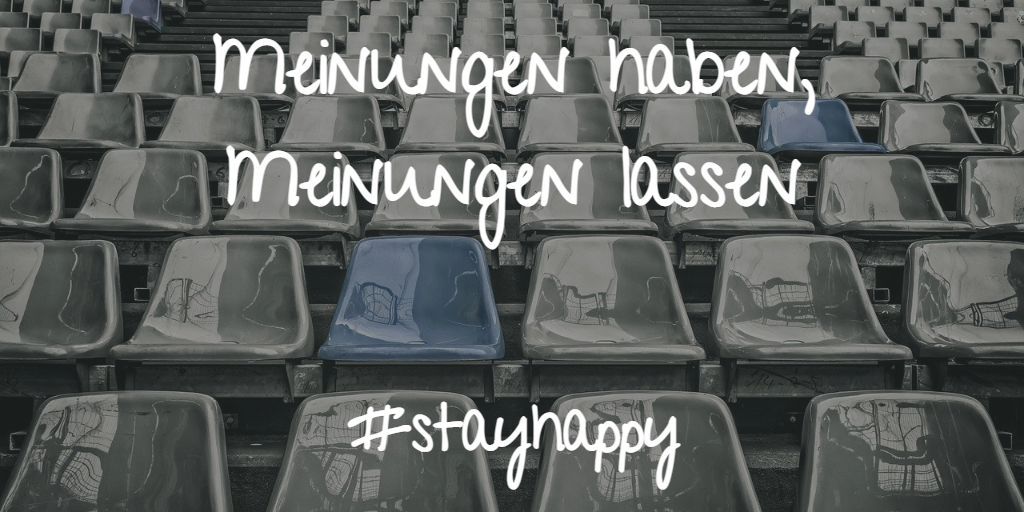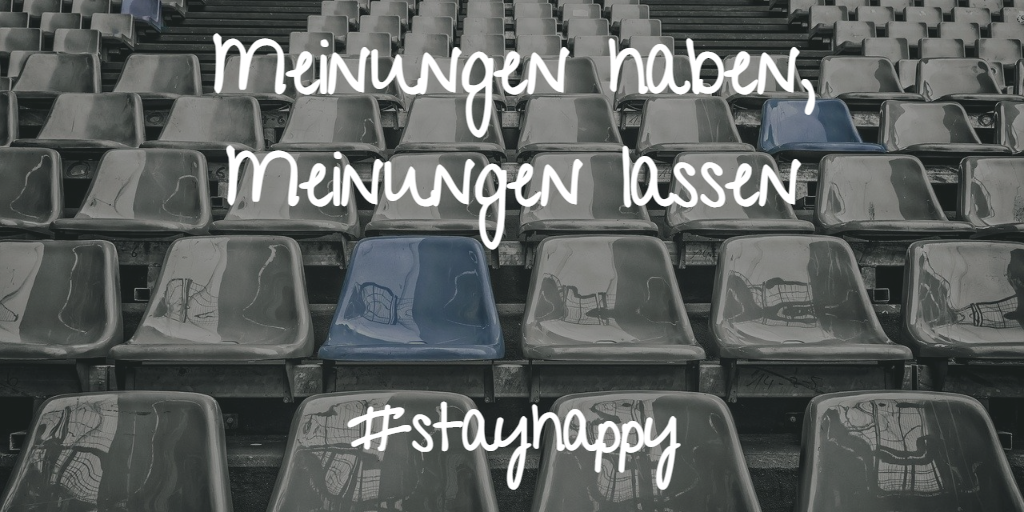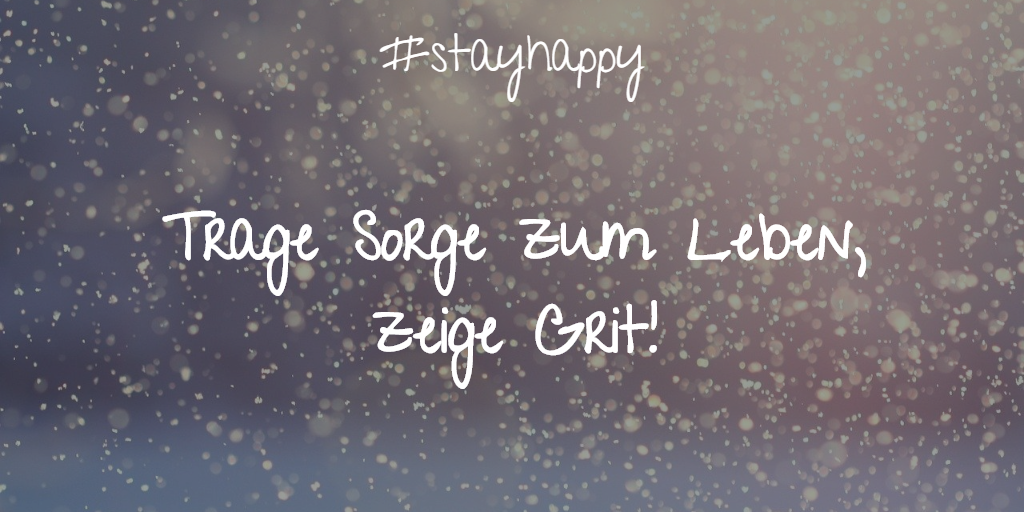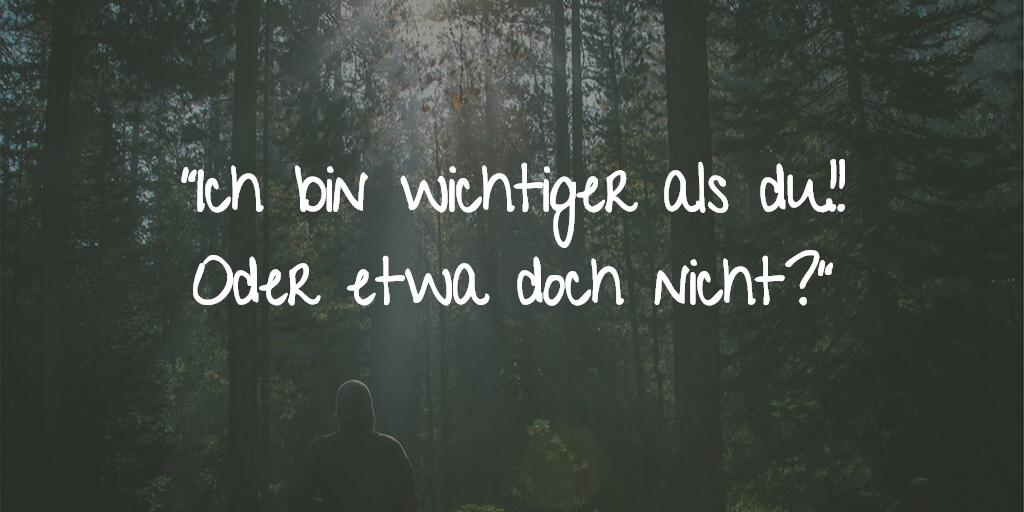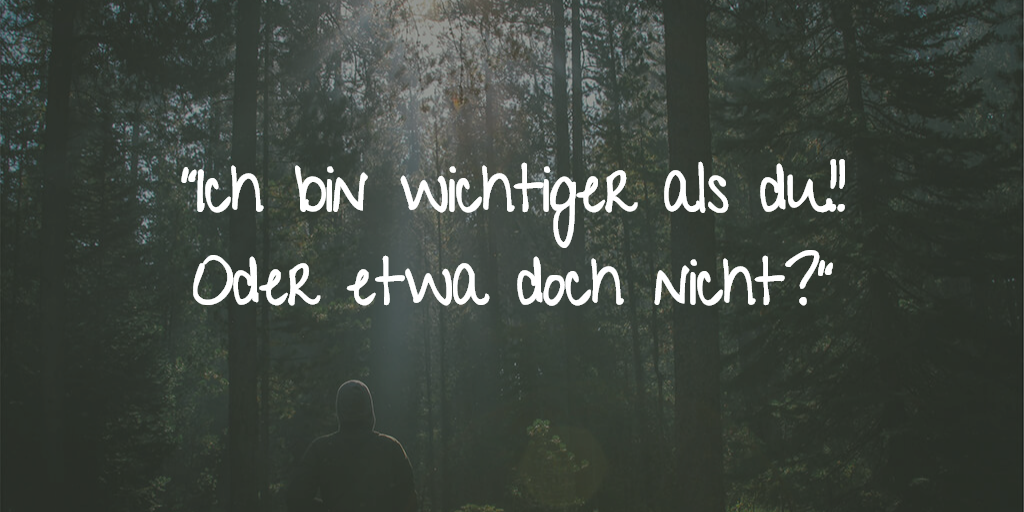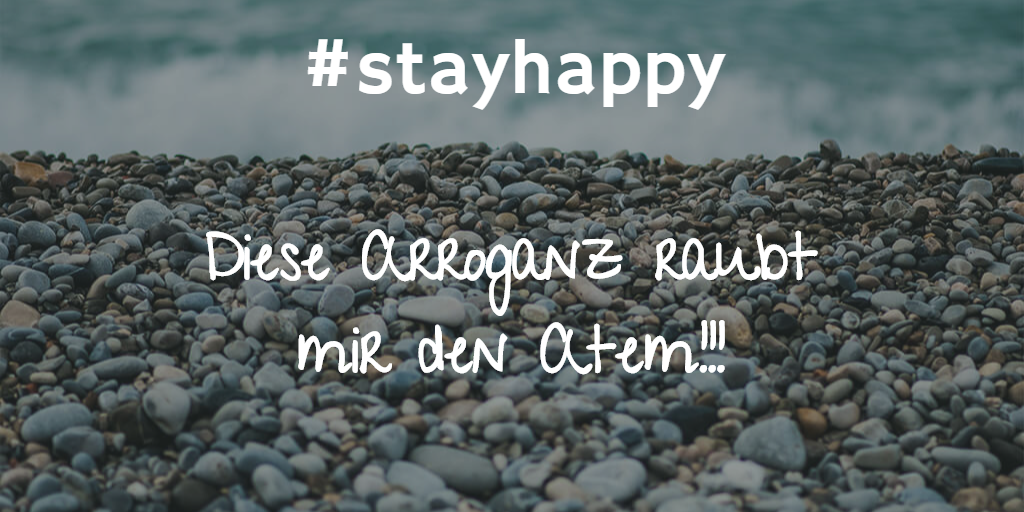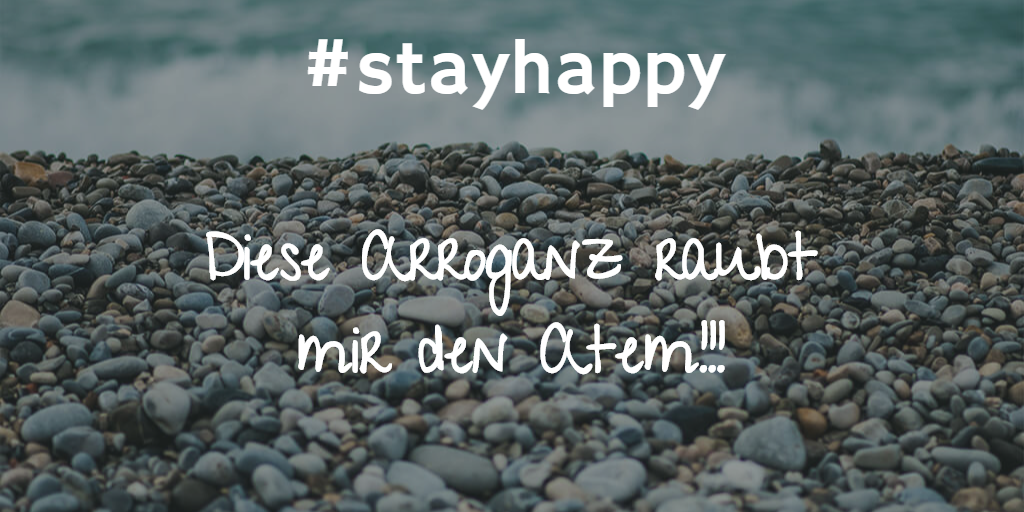Es gibt da rund um Ostern diese Geschichte von zwei Männern aus dem Freundeskreis von Jesus, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren – voller Irritation und Enttäuschung, Trauer und Mutlosigkeit.
Aus irgendeinem Grund liebte unser Sohn diese Geschichte in seiner Kinderbibel ganz besonders, immer und immer wieder wollte er, dass wir ihm genau diese Geschichte erzählten.
Und tatsächlich: Es ist eine wunderschöne Geschichte, die auch uns heute viel mitgeben kann.
Am Ziel angekommen, sagen die beiden Freunde zueinander: »Brannte nicht unser Herz in uns …?« Oder in einer anderen Übersetzung heisst es: »Hat es uns nicht tief berührt …?«.
Ich sehe sie vor meinem inneren Auge, wie sie sich niedergeschlagen auf ihre Wanderung machen. Am Ziel angekommen, dann wenn ich müde von den Anstrengungen wäre, sprang ihr Herz vor Freude – so sehr, dass sie – wenn sie denn heute leben würden – sofort eine Insta-Story gepostet hätten und in ihrer WhatsApp-Chatgruppe »Follower of Jesus« geschrieben hätten: »Ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist …«.
Da sich die Geschichte aber vor rund 2000 Jahren abspielte, blieb ihnen nichts anders übrig, als nochmals die mehrstündige Wanderung unter ihre Füsse zu nehmen, um ihre Freude mit ihren Freunden teilen zu können.
Als Weggemeinschaft unterwegs
Was ist geschehen? Was war der Grund für diesen frappanten Stimmungswechsel?
Die beiden Freunde, auch Emmaus-Jünger genannt, sind also traurig, irritiert und voller Fragen unterwegs. Sie reflektieren die Geschehnisse der letzten Tage: Eben noch – gerade mal eine Woche ist es her – wurde ihr Freund und Rabbi Jesus triumphal als König in Jerusalem willkommen geheissen, nach intensiven Tagen genossen sie eine feierliche Mahlzeit mit dem gemeinsamen Abendmahl; dann ging es Schlag auf Schlag – Verhaftung von Jesus, (Schein)Verhör, Anschuldigungen des manipulierten Mobs, Misshandlung, qualvoller Weg nach Golgatha, Leiden am Kreuz, letztes Aufschreien ihres Lehrers, Tod.
Aus und vorbei. Tod ihres Freundes, Tod einer Bewegung, Tod einer Hoffnung.
Zu allem Übel dazu wurde nun auch noch der Leichnam gestohlen; das Grab ist leer, voll sind dafür Kopf und Herz der zurückbleibenden Freunde: voller Irritation, Verunsicherung und Fragen.

Das kommt mir bekannt vor: Für mich bleibt das Leben immer wieder ein Rätsel. Dann geht es mir wie den beiden Emmaus-Jünger – traurig, irritiert, voller Fragen.
In dieser Gefühlslage sind sie also auf ihrem Weg unterwegs. Plötzlich schliesst sich eine dritte Person dieser fragenden Weggemeinschaft an. Es ist Jesus selbst, der Auferstandene. Nein, sein Leichnam wurde nicht gestohlen, er ist nicht (mehr) tot, die Hoffnung lebt, die Bewegung wird sich von jetzt an über die ganze Welt ausbreiten wird selbst 2000 Jahre später eine wachsende Bewegung sein.
Doch von all dem wissen die Freunde noch nichts, sie erkennen nicht einmal ihren Freund Jesus. Im Gegenteil, schon fast überheblich sagen sei zu ihm: «Du bist wohl der Einzige, der nicht versteht, was hier gerade abgeht!?».
Doch, doch, das tut er schon. Aber es gehört zu seiner Art, dass er sich erst mal den Fragen der Emmaus-Jünger annimmt, zuhört, bevor er spricht. Und dann hilft er ihnen die Zusammenhänge zu erkennen, ganz am Ende der Begegnung gibt er sich zu erkennen. Jetzt gibt es für die Freunde kein Halten mehr: Ihr Herz springt vor Freude. Jesus lebt! Das müssen sie sofort Petrus und den anderen erzählen … Mit neuer Kraft und Zuversicht machen sie sich beschwingt nochmals auf den Weg.
Genau wie die Emmaus-Jünger wünsche ich mir, mit den Menschen um mich herum als «Weggemeinschaft» dem Geheimnis des Lebens und Glaubens auf die Spur zu kommen. Und dies ganz im Jesus-Stil: Zuhörend, nachfragend, liebevoll, nicht verurteilend, fragend, suchend, offen.
Die Rätsel unserer Zeit mögen gross sein.
Die Verunsicherung dieser Tage mag gross sein.
Deine persönlichen Herausforderungen mögen gross sein.
Noch grösser bleibt das Wunder von Ostern:
Jesus hat den Tod besiegt.
Alles Quälende wird nicht das letzte Wort haben.
Weil das letzte Wort ein gutes Wort sein wird.
Denn: Jesus lebt!
Der Auferstandene möchte auch heute in uns leben und Teil unserer Weggemeinschaft sein!
Frohe und gesegnete Ostern!