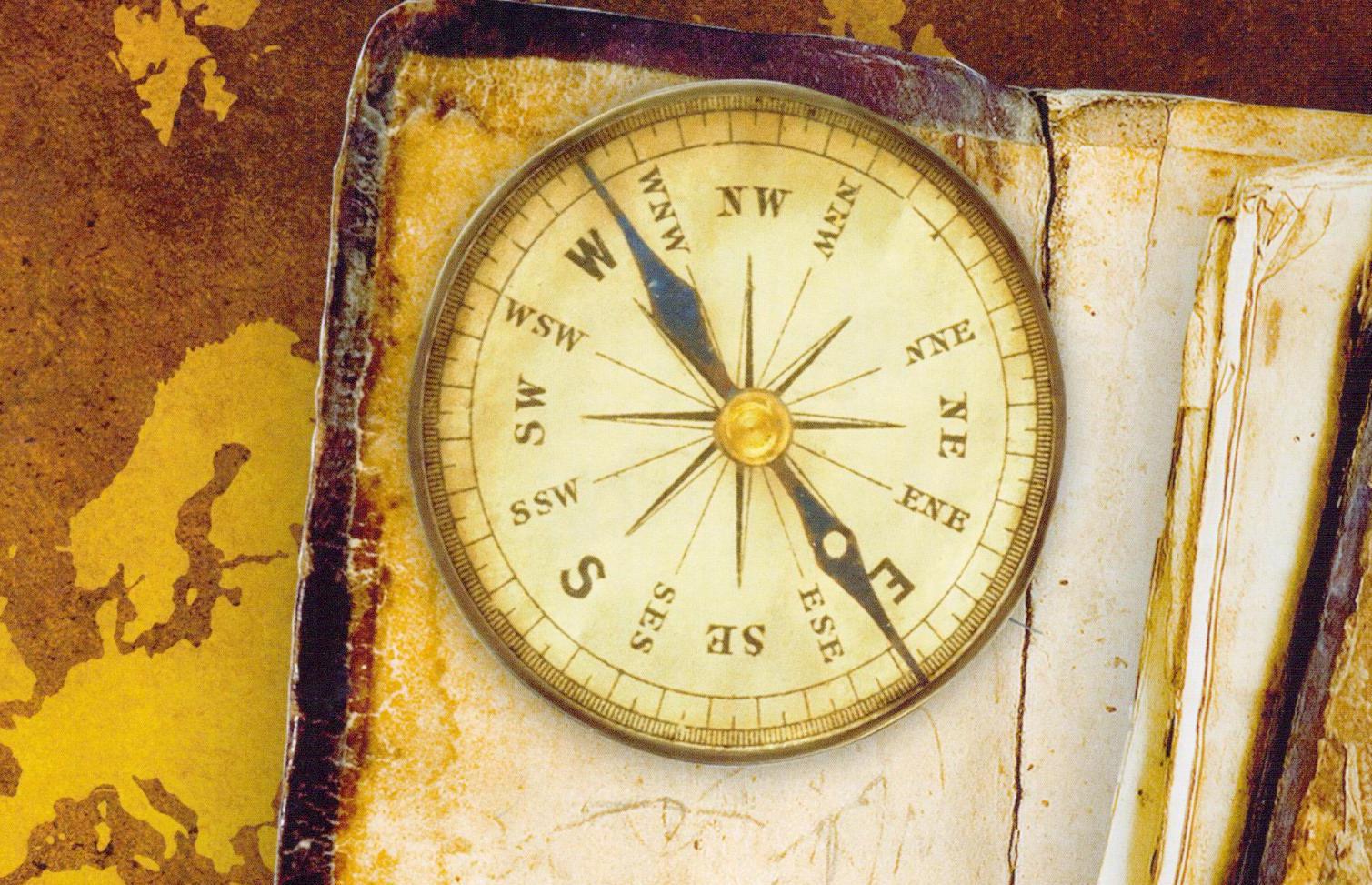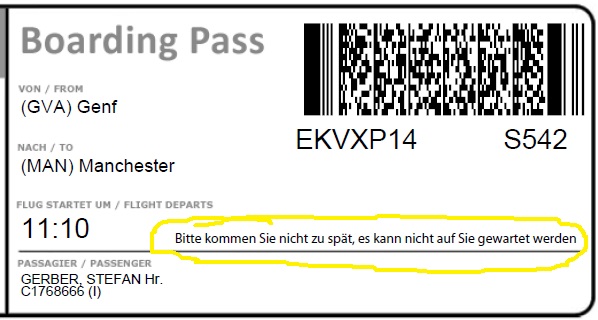Oh, I get by with a little help from my friends
Mm, I get high with a little help from my friends
Mm, I’m gonna try with a little help from my friends
The Beatles (With A Little Help From My Friends)
Als ich über den Umstand nachdachte, dass jetzt, Mitte Januar, schon wieder die meisten Neujahrsvorsätze gescheitert sind, kam mir dieser Beatles Song in den Sinn. Mir ist vor allem die Joe Cocker Version von Whit a little help from my friends bekannt. Der Song handelt von verschiedene Lebenssituationen und mündet immer wieder in den oben zitierten Refrain, der uns daran erinnert, dass wir es gemeinsam schaffen können: „Oh, ich schaff’s mit bisschen Hilfe meiner Freunde. Mm, fühl mich gut mit etwas Beistand meiner Freunde. Mm, sollte es probieren mit ein wenig Unterstützung meiner Freunde.“
Damit unsere Vorsätze und Ziele nicht schon im Vornherein zum Scheitern verurteilt sind, sehe ich vor allem zwei Schlüssel, die uns die Tür zum Erfolg öffnen können:
1. Motivierende Ziele
2. Kraft der Gemeinschaft
Ziele, die uns motivieren und Freunde, die uns anfeuern
Ganz viele Vorsätze und Ziele – wahrscheinlich sind es die meisten – sind nicht wirklich motivierend. Entweder sind sie uns von einem Chef ohne unsere persönliche Mitsprache überstülpt worden, oder aber sie sind auf Defizite fokussiert. Und wenn ich mich gedanklich mit dem beschäftige, was nicht gut ist, motiviert mich dies nicht gerade spürbar. „Ich muss die überzähligen Kilos verlieren!“ oder: „Ich will mich im neuen Jahr unbedingt mehr bewegen!“ sind alles gut gemeinte Vorsätze, aber sie führen uns kaum ans Ziel, weil sie nicht motivierend sind.
Das mit der Motivation ist etwas komplizierter. Die intrinsische Motivation (also die Motivation, die wir quasi in uns tragen) ist unheimlich stark und zu vielem fähig – selbst bei widrigen Umständen, doch ihre Charakteristik ist eben gerade, dass man sie nicht aufzwingen oder durch gutes Zureden heraufbeschwören kann: Intrinsische Motivation hat mit dem zu tun, was uns aus eigenem Antrieb motiviert. Nicht weil es andere gut finden, nicht weil es im Trend ist, nicht weil der Verstand es uns sagt.
Der zweite Schlüssel ist etwas einfacher – und lässt sich daher wie gesehen auch gut in einen Song verpacken: Wenn ich es nicht alleine versuche sondern mir Unterstützer zur Seite stelle, steigen die Chance zum erfolgreichen Umsetzen eines Zieles in die Höhe. Ganz nach dem Motto: „Was ich alleine nicht schaffe, schaffen wir gemeinsam.“ Schon nur einem Freund die eigenen Ziele und Vorsätze bekanntzugeben, ist sehr kraftvoll. Wenn wir ihn dann auch noch bei der Umsetzung einbeziehen können, ist der Erfolg schon fast greifbar.
Während der pauschale Vorsatz „Mehr Sport“ für mich keine intrinsische Motivation enthält, motiviert mich die Möglichkeit, Unihockey zu spielen sehr. So habe ich mich vor etwa einem Jahr einer Gruppe angeschlossen, in der wir uns wöchentlich zum gemeinsamen Spiel treffen. Nun kann ich beide Schlüssel zum Erfolg kombinieren und die Kraft der Gemeinschaft sowie die intrinsische Motivation nutzen, um mich mehr zu bewegen.
WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE
- Ältere Artikel zum Thema Neujahrsvorsätze: Happy New Year, Meinen Nordstern leuchten lassen
- Gemeinschaft macht glücklich – ältere Blogartikel zum Thema: Glücksfaktor Nächstenliebe, Gemeinschaftswerk entsteht, Weltverbesserer, You & Me
- Nutzen Sie ihre intrinsische Motivation und die Kraft der Unterstützung einer Drittperson: In einem Coaching können Sie beides kombinieren.
Mein Blogbeitrag dieser Woche dreht sich um den Lebensbereich “Gesellschaft“.