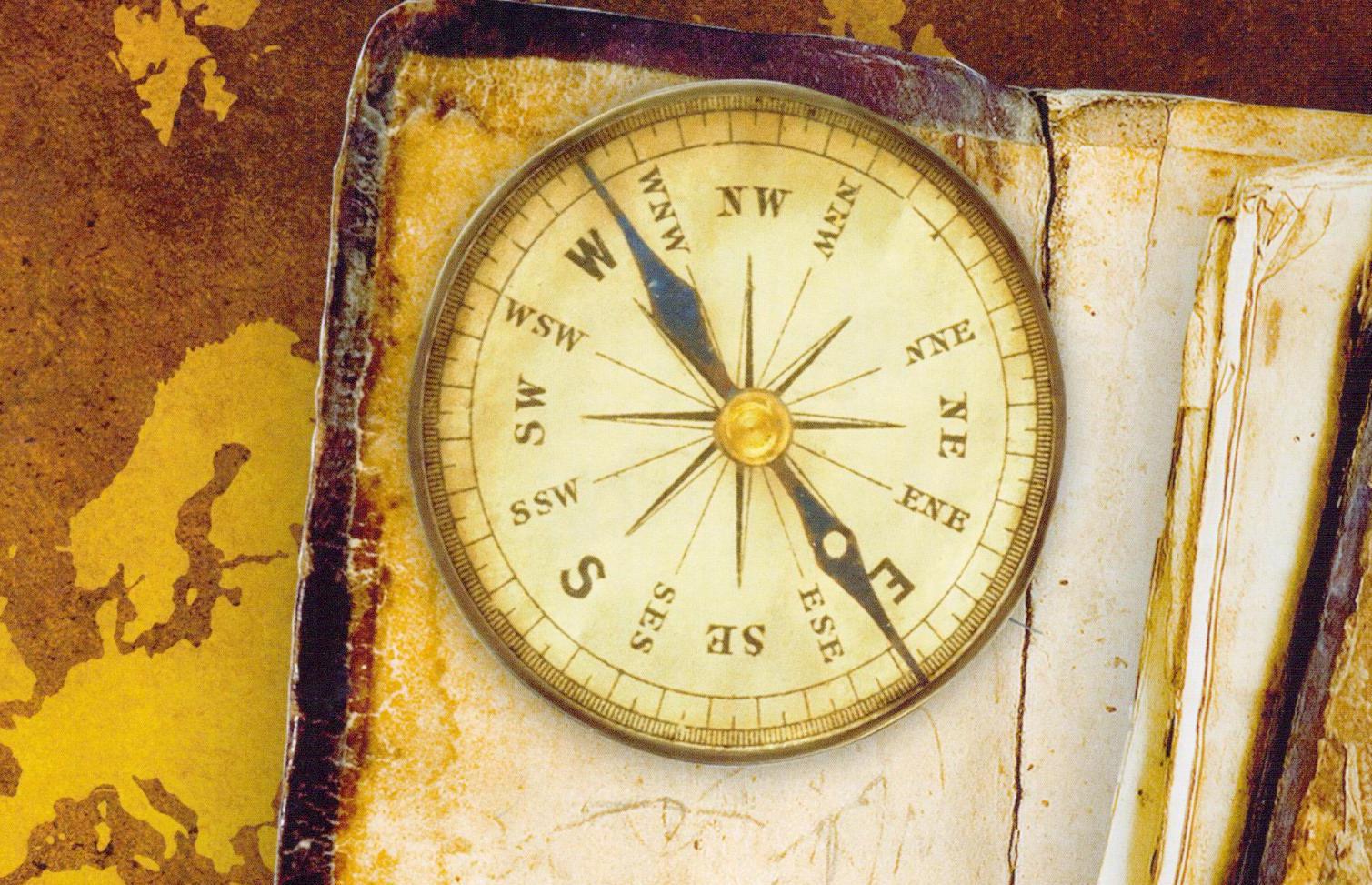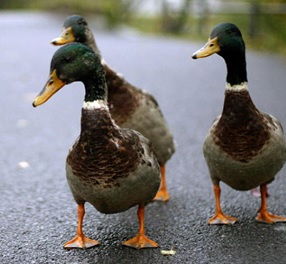Der Erfolgreiche überprüft seine Begabungen und Fähigkeiten,
ehe er sein Ziel steckt.
Vera F. Birkenbihl
Letzten Sonntag durften wir einmal mehr mit unserem Impulsreferat Leben in Balance einen Anlass bereichern. Nach dem Referat kam jemand auf mich zu und fragte: „Was sind wir nun, Hamster oder Enten?“
In meinem Teil des Referates erklärte ich, dass das Leben viel mehr zu bieten hat als das Hamsterrad. Viel zu oft leben und arbeiten wir als Getriebene von unseren To-Do’s und den selbstauferlegten oder von einem Chef aufgebrummten Zwängen. Es ist Zeit, dass wir das Hamsterrad verlassen.
Meine Frau erzählte in ihrem Erfahrungsbericht die Geschichte vom Entchen. Die Ente kann schwimmen und gehen – oder besser: watscheln. Aber das andauernde Watscheln sorgt für wunde Füsse. Das bevorzuge Element des Entchens ist das Wasser. Und so gilt es auch für uns, der Frage nachzugehen, welches Element am besten zu uns passt.
Meine Stärken kennen
An einem Mitarbeitertreffen fragte ich gestern in die Runde: „Wo merkst du: ‚Das ist nicht mein Ding!‘?“ Und dann: „Wo erlebst du: ‚Hier blüh ich auf!‘?“ Das war eine interessante Gesprächsrunde und als eine Person erzählte, bei welcher Tätigkeit sie aufblüht, entwich einer anderen Mitarbeiterin ein herzhaftes „Ou nei!“. Das ist das Wunderbare an der Unterschiedlichkeit von uns Menschen: Nicht jeder blüht im selben Element auf. Was für mich nicht „mein Ding“ ist, kann für den anderen genau der Ort sein, an dem er so richtig aufblüht.
Soweit so gut. Die Herausforderung ist nur, seine Stärken herauszufinden, sie zu akzeptieren und dann Orte zu finden, wo man sich mit seinen Stärken einbringen kann. Wie gerne hätte ich in der Jugendzeit etwas mehr von den Stärken meines Freundes gehabt. Er konnte so gut mit (fremden) Menschen ins Gespräch kommen… Aber: Wenn ich sein will wie du und du sein willst wie ich, verlieren wir beide!
Gesucht: Chef, der meine Stärken fördert
Meine Einzigartigkeit kann ein Geschenk für die Welt sein. Vielleicht ist es eine Utopie, doch ich träume von einer Welt – auch von einer Arbeitswelt – in der Menschen ihre persönlichen Stärken und ihre ganz eigene Note einbringen können. Arbeitnehmer und Arbeitgeber in ihrem Element, weil sie das tun, was sie am besten können.
In seinem Buch Die Chef-Falle schreibt Jörg Knoblauch: „Immer wieder höre ich von Angestellten, die gekündigt haben, dass ihre Aufgabe ihnen eigentlich Freude gemacht hat. Aber ihre Chefs waren unerträglich. Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sondern ihren Vorgesetzten.“
Manchmal macht eine Aufgabe auch ohne guten Chef Spass. Doch ausgezeichnete Führungspersonen finden Aufgaben, die zu ihren Mitarbeitenden passen und diese zum Aufblühen bringen. Denn: Wenn wir nach unseren Stärken eingesetzt werden, erleben wir nicht nur persönlich mehr Freude, sondern auch der Betrieb als Ganzes profitiert.
WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE
- Weitere Artikel im Bereich Arbeitszufriedenheit: Mein Element finden und Traumjob-Dreieck.
- Sie fühlen sich als Hamster im Hamsterrad oder wie das Entchen mit wunden Füssen? Gönnen Sie sich eine Pause! Unsere Timeout-Weekends helfen Ihnen Kraft zu tanken und wieder aufzublühen.
- Aktuell: Motivationstag Leben in Balance
- Mit unseren unterschiedlichen Coaching-Packages unterstützen wir Sie auf Ihrem nächsten Schritt in Ihrer Laufbahn.
- Buchtipp: Die Chef-Falle.
Mein Blogbeitrag dieser Woche dreht sich um den Lebensbereich “Arbeit“.